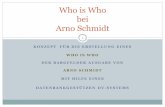Masterthesis Der Digitalisierungsgrad der Schweizer ... · 3.7.3 Anwendungsbeispiele 39 3.8...
Transcript of Masterthesis Der Digitalisierungsgrad der Schweizer ... · 3.7.3 Anwendungsbeispiele 39 3.8...

Masterthesiszur Erlangung des
Master of Science in Real Estate (CUREM)
Der Digitalisierungsgrad der Schweizer Architekturbüros
Name: Reto Kunz
Adresse: Pfirsichstrasse 15, 8006 Zürich
Eingereicht bei: Prof. Friedrich HäubiProf. Dr. Manfred Breit
Abgabedatum: 14. August 2009

Vorwort I
——————————————————————————————————————————
Vorwort
Nach einigen Jahren Berufserfahrung als praktizierender Architekt bot sich mir mit dem
Besuch des Studienganges der CUREM die Gelegenheit, mein immobilienwirtschaftli-
ches Wissen zu vertiefen. Trotz des geweckten Interesses und der Neugier für finanzma-
thematische und wirtschaftliche Fragen wählte ich als Gegenstand meiner Masterthesis
kein rein immobilienwirtschaftliches Thema.
Während des ganzen Berufslebens begleitete mich eine stete Neugier für neue Techni-
ken und Prozesse im Zusammenhang mit dem Computer. Die vorliegende Arbeit bot
mir einerseits die Möglichkeit, zu eruieren, in welchem Masse Schweizer Architektur-
büros digitale Hilfsmittel einsetzen, anderseits konnte ich mich so im Rahmen einer
Forschungstätigkeit persönlich weiterbilden und sehen, wie meine Berufskollegen mit
dem Phänomen der Digitalisierung umgehen. Trotz des persönlichen Interesses und der
Faszination für das Thema ist es mein Ziel, mit dieser Arbeit einen objektiven Beitrag –
einen kleinen Mosaikstein – für die Forschung zu leisten.
Diese Masterthesis hätte nicht ohne Mithilfe weiterer Personen in der vorliegenden
Form entstehen können. Mein Dank gilt insbesondere meinem Betreuer Prof. Friedrich
Häubi und meinem Koreferenten Prof. Dr. Manfred Breit für das mir entgegengebrachte
Interesse und Vertrauen. Ebenfalls an dieser Stelle bedanken möchte ich mich bei Mi-
chael Raps vom Institut für 4D-Design in Windisch für das Aufschalten der Online-Um-
frage und seine Geduld meinen Fragen und Änderungswünschen gegenüber.
Ein besonderer Dank gilt meinen Architekten-Kollegen, die die Umfrage vorab testeten,
allen Büros, die an der Online-Umfrage teilgenommenen haben, und auch meinen Inter-
viewpartnern Prof. Dr. Ludger Hovestadt von der ETH Zürich, Jost Kutter und Micha
Bucher vom Büro Itten+Brechbühl. Gleichermassen dankbar bin für die Gelegenheit,
die mir die CUREM bot, diese Masterthesis zu verfassen, wie auch dem Büro VPA und
Peter Voelki für die mir gewährten Absenzen. Ein grosser Dank geht an Heinz und Ste-
phanie Kunz für ihre Mithilfe am sprachlichen Feinschliff. Mein grösster Dank gilt
Gisela, die mich während der anderthalb Jahre CUREM viele Male hinter meinen Ord-
nern und Büchern verschwinden sah.
Zürich, 14. August 2009 Reto Kunz

Inhaltsverzeichnis II
——————————————————————————————————————————
Vorwort I
Inhaltsverzeichnis II
Abbildungsverzeichnis V
Abkürzungsverzeichnis VIII
1 Einleitung 1
1.1 Ausgangslage 1
1.2 Zielsetzung 3
1.3 Arbeitshypothesen 3
1.4 Vorgehensweise und Methodik 4
1.5 Vergleichbare Untersuchungen 5
1.6 Thematische Abgrenzung 6
2 Theoretische Grundlagen 7
2.1 Die Bauplanung im immobilienwirtschaftlichen Kontext 7
2.2 Rationalisierung aus wirtschaftstheoretischer Sicht 9
2.3 Entwicklung des Computers als Wegbereiter neuer Arbeitsmethoden 14
3 Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 17
3.1 Ablauf einer Bauplanung nach SIA 112 18
3.1.1 Phase 1: Strategische Planung 18 3.1.2 Phase 2: Vorstudien 18 3.1.3 Phase 3: Projektierung 20 3.1.4 Phase 4: Realisierung 23 3.1.5 Phase 5: Nutzung 25
3.2 Schnittstellenproblematik 26
3.3 Kriterien der Hierarchisierung 27
3.4 Computer Aided Architectural Drafting – Zweidimensionale Pläne 28
3.4.1 Grundlagen und Möglichkeiten 28 3.4.2 Grenzen und Problempunkte 28

Inhaltsverzeichnis III
——————————————————————————————————————————
3.4.3 Anwendungsbeispiele 29
3.5 Computer Aided Architectural Design – Dreidimensionale Modelle 30
3.5.1 Grundlagen und Möglichkeiten 30 3.5.2 Grenzen und Problempunkte 31 3.5.3 Anwendungsbeispiele 32
3.6 Computer Aided Architectural Design – Parametrisiertes Entwerfen 32
3.6.1 Grundlagen und Möglichkeiten 32 3.6.2 Grenzen und Problempunkte 34 3.6.3 Anwendungsbeispiele 35
3.7 Computer Aided Manufacturing (CAM) – Digitalisierte Produktion 36
3.7.1 Grundlagen und Möglichkeiten 36 3.7.2 Grenzen und Problempunkte 38 3.7.3 Anwendungsbeispiele 39
3.8 Building Information Modeling (BIM) 39
3.8.1 Grundlagen und Möglichkeiten 39 3.8.2 Grenzen und Problempunkte 42 3.8.3 Anwendungsbeispiele 43
3.9 Gebäudeautomation 43
3.9.1 Grundlagen und Möglichkeiten 43 3.9.2 Grenzen und Problempunkte 44 3.9.3 Anwendungsbeispiele 44
3.10 Internet-basierende Planungsplattformen 45
3.11 Vergleich der Planungsphasen mit den Computereinsatzmöglichkeiten 45
3.12 Grad der Digitalisierung 47
4 Datenermittlung 48
4.1 Online-Umfrage 48
4.1.1 Definition der Untersuchungseinheiten 48 4.1.2 Definition der Untersuchungsmerkmale 50 4.1.3 Frageliste und Antwortmöglichkeiten 51 4.1.4 Durchführung der Umfrage 55
4.2 Datenauswertung und Datenanalyse 56
4.2.1 Generelle Information 56 4.2.2 Zugang zu Computern und Kommunikationsmitteln 58 4.2.3 Allgemeiner Computereinsatz 60 4.2.4 Architektenspezifischer Computereinsatz 60 4.2.5 Zusammenarbeit und Netzwerke 63

Inhaltsverzeichnis IV
——————————————————————————————————————————
4.2.6 Vorteile und Nachteile der zunehmenden Digitalisierung 64 4.2.7 Zukünftige Investitionen im IT-Bereich und deren Motivation 70
4.3 Interviews mit ausgewählten Gesprächspartnern 73
4.3.1 Auswahl der Gesprächspartner 73 4.3.2 Interview mit Ludger Hovestadt 73 4.3.3 Interview mit Jost Kutter 74
5 Schlussfolgerungen 76
5.1 Erkenntnisse aus der Datenermittlung 76
5.1.1 Zeichnen von zweidimensionalen vektoriellen Plänen 76 5.1.2 Aufbau von dreidimensionalen geometrischen Modellen 77 5.1.3 Einsatz von Parametrisierung als Entwurfsmittel 77 5.1.4 3D-Gebäudemodelle zur Bauteilproduktion bzw. Modellbau 78 5.1.5 Durchgehende Digitalisierung mittels BIM 79 5.1.6 Aussagen zur statistischen Signifikanz 79
5.2 Vergleich im internationalen Rahmen 80
5.3 Arbeitshypothesen 82
5.4 Ausblick für das Metier des Architekten 83
6 Zusammenfassung 84
Anhang IX
A Wortlaut des Einladungsmails für die Online-Umfrage IX
B Wortlaut des Interviews mit Prof. Dr. Ludger Hovestadt X
Literatur- und Datenverzeichnis XV
Ehrenwörtliche Erklärung XIX

Abbildungsverzeichnis V
——————————————————————————————————————————
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Arbeitsproduktivität in drei ausgewählten Branchen; Quelle: Bundesamt für Statistik BfS: Arbeitsproduktivität nach Branchen in Franken pro vollzeitäquivalente Beschäftigung, File: je-d-04.03.04.02.xls
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/lexikon/bienvenue___login/blank/zugang_lexikon.Document.112808.xls> , Abrufdatum: 26.04.2009, 13.20 Uhr; eigene Darstellung.
Abbildung 2: Längerfristige Branchenpositionierung; Quelle: UBS Outlook Q1/2009: Branchenspiegel; Folien zur Schweizer Konjunktur (Stand: März 2009), <http://www.ubs.com/1/ShowMedia/ubs_ch/bb_ch/market_information/forecasting/konjunktur?contentId=117895&name=Konj_www_d.pdf >, Abrufdatum: 26.04.2009, 12.00 Uhr.
Abbildung 3: Haus der Immobilienökonomie (nach Prof. Dr. Karl-Werner Schulte); Quelle: Schulte Hrsg. (2005), Immobilienökonomie Band I (3. Aufl.), S. 58 & eigene Darstellung.
Abbildung 4: Real Estate System; Quelle: Patel, Kanak: Real Estate Space and Asset Market & eigene Darstellung.
Abbildung 5: Prospettiva di Città ideale; entstanden um 1470 am Hof des Federico da Montefeltre in Urbino; unbekannter Maler; [Original in: The Walters Art Gallery, Baltimore].
Abbildung 6: Verhältnis von Kosten zu deren Beeinflussbarkeit; Quelle: CUREM-Skript der Vorlesung 'Kostenplanung' von Prof. Dr. Christian Stoy, Insti-tut für Bauökonomie, Universität Stuttgart, & eigene Darstellung.
Abbildung 7: Beispiel eines schematischen Geschossgrundrisses eines Altersheimes zur Klärung der generellen Machbarkeit; Quelle: Machbarkeitsstudie als Grundlage des Projektwettbewerbes Dreilinden, Luzern, 2007; Verfas-ser: Itten + Brechbühl AG, Bern.
Abbildung 8: Grundrissausschnitt einer Baueingabe mit den üblichen Farben (schwarz: Bestand, rot: Neu, gelb: Abbruch); Quelle: Baueingabe Sport-zentrum Migros Greifensee, 2003; Architekten: Voelki Partner AG Ar-chitekten, Zürich.
Abbildung 9: Beispiel eines Detailschnittes des Sockels als Grundlage für die Submis-sion; Quelle: Werkplanung Sportzentrum Migros Greifensee; Architek-ten: Voelki Partner AG Architekten, Zürich.

Abbildungsverzeichnis VI
——————————————————————————————————————————
Abbildung 10: Die phasenweise Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure bedingt viele verschiedene Schnittstellen; Quelle: eigene Darstellung.
Abbildung 11: Beispiel einer zweidimensionalen, vektorbasierten Zeichnung; Quelle: Architekturpreis Eternit (Studentenwettbewerb 1999), eigener Beitrag.
Abbildung 12: Beispiel einer Visualisierung: 1: Drahtmodell, 2: Flächenmodell, 3: Vo-lumenmodell, 4: Körpermodell (Rendering) als Nacht-Lichtstudie, 5: Tag-Lichtstudie, 6: Fertiges Bild; Quelle: Visualisierung des Wettbe-werbsbeitrages Alterszentrum Dreilinden Luzern, 2007; Verfasser: Voel-ki Partner AG Architekten, Zürich.
Abbildung 13: Wohnungsgrundriss einer 4½-Zimmer-Wohnung und zwei Möglichkei-ten der Abstraktion; Quelle: Ausgeführtes Projekt ACCU-Areal, Zürich-Oerlikon; Verfasser: Voelki Partner AG Architekten, Zürich & eigene Darstellung.
Abbildung 14: Beispiel einer computergenerierten und von einem Industrieroboter ge-mauerten Ziegelsteinwand (Schweizer Beitrag an der Architektur-Bien-nale in Venedig, 2008); Quelle: Gramazio, Fabio / Kohler, Matthias (2008): Digital Materiality in Architecture; Baden, 2008; S. 60 und 106.
Abbildung 15: CNC-gesteuertes Fräsen als ein subtraktives Verfahren; Quelle: Grama-zio, Fabio / Kohler, Matthias (2008): Digital Materiality in Architecture; Baden, 2008; S. 60 und S. 15.
Abbildung 16: Prinzipskizze des Sinterns mit Laser (links) und des 3D-Druckers; Quel-le: Schodek (2005): Digital Design and Manufacturing – CAD / CAM Applications in Architecture and Design; New Jersey. S. 291.
Abbildung 17: Computergenerierte und mittels CNC-Fräsen hergestellte Betonschalun-gen (Projekt: Neuer Zollhof, Düsseldorf, Architekt Frank O. Gehry); Quelle: Kolarevic (2003): Architecture in the digital age: design and ma-nufacturing, New York; S. 108.
Abbildung 18: Vergleich zwischen BIM, parametrischem Entwerfen, objektorientiertem CAD und konventionellem CAD; Quelle: Autodesk (2003): Building In-formation Modeling in Practice, White Paper,
http://images.autodesk.com/emea_apac_main/files/bim_in_practice.pdf Abrufdatum: 03.05.2009, 18.10 Uhr.
Abbildung 19: Das nach BIM-Massstäben erstellte Gebäudemodell lässt sich für die verschiedensten Simulationen und Analysen einsetzen. Quelle: Eastman, Chuck et al. (2008): BIM Handbook; New Jersey USA, 2008; S. 346 ff.

Abbildungsverzeichnis VII
——————————————————————————————————————————
Abbildung 20: Vergleich der Planungsphasen mit den Computereinsatzmöglichkeiten; eigene Darstellung.
Abbildung 21: Grössenklassengliederung der Schweizer Architektur- und Ingenieurbü-ros nach Büros und Mitarbeitern; Quelle: BfS, SIA & eigene Darstel-lung.
Abbildung 22: SIA Firmenmitglieder nach Kantonen / für die Online-Umfrage taugliche Büros; Quelle: SIA & eigene Darstellung.
Abbildung 23: Aufteilung der Gesamtanzahl Mitarbeiter, Computer und E-Mail-Adres-sen nach Bürogrösse gegliedert; Quelle: Online-Umfrage & eigene Dar-stellung.
Abbildung 24: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer zum Zeichnen von zweidimensionalen, vektoriellen Plänen benutzen, nach Bürogrösse gegliedert; Quelle: Online-Umfrage & eigene Darstellung.
Abbildung 25: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer zur Er-stellung von dreidimensionalen, geometrischen Gebäudemodellen benut-zen, nach Bürogrösse gegliedert; Quelle: Online-Umfrage & eigene Dar-stellung.
Abbildung 26: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer einsetzen zur Parametrisierung des Entwurfes, nach Bürogrösse gegliedert; Quelle: Online-Umfrage & eigene Darstellung.
Abbildung 27: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer zur Her-stellung von Bauteilen oder zum Modellbau benutzen, nach Bürogrösse gegliedert; Quelle: Online-Umfrage & eigene Darstellung.
Abbildung 28: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer für die durchgehende Digitalisierung (BIM) ihrer Projekte benutzen, nach Büro-grösse gegliedert; Quelle: Online-Umfrage & eigene Darstellung.
Abbildung 29: Aufteilung des CAD-Einsatzes in Skandinavien; Quelle: Samuelson, Olle (2008): The IT-barometer – a decade's development of IT use in Swedish construction sector, [in: Journal of Information Technology in Construction, ITcon Vol. 13, S. 1-19]; <h ttp://www.itcon.org/2008/1 >, Abrufdatum: 02.05.2009, 20.20 Uhr; Helsinki, 2008; S. 9.
Abbildung 30: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros nach ihrem Digitalisierungs-grad; Quelle: Online-Umfrage & eigene Darstellung.

Abkürzungsverzeichnis VIII
——————————————————————————————————————————
Abkürzungsverzeichnis
AEC: Architecture, Engineering and Construction
BfS: Bundesamt für Statistik
BIM: Building Information Modeling
CAAD: Computer Aided Architectural Design
CAD: Computer Aided Design
CICA: Construction Industry Computing Association
CIFE: Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University
CIM: Computer Integrated Manufacturing
CNC: Computerized Numerical Control, computerisierte numerische Steuerung
CRB: Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung
FM: Facility Management
HLKKS: Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Sanitärtechnik
IAI: International Alliance of Interoperability
IFC: Industry Foundation Classes
ISO: International Organization for Standardization
KV: Kostenvoranschlag
SIA: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverband

Einleitung 1
——————————————————————————————————————————
1 Einleitung
1.1 Ausgangslage
Der zunehmende Einsatz neuer Technologien und Prozesse hat in den letzten Jahren und
Jahrzehnten einen Grossteil der gesamten Volkswirtschaft strukturell und nachhaltig be-
einflusst. Rechnergestützte Anwendungen halfen mit, die Wertschöpfung in den einzel-
nen Branchen zu erhöhen. Angestammte Berufsbilder erfuhren grundlegende Änderun-
gen; neue, spezialisierte Betätigungsfelder entstanden. Als direkte Konsequenz aus dem
vermehrten Einsatz informationstechnischer Werkzeuge ist ein klar erkennbarer Zu-
wachs an Produktivität pro Arbeitsplatz in den meisten Branchen erkennbar.
Jedoch profitieren nicht alle Branchen gleich stark davon. Die Planungs- und Bauindus-
trie mit rund 5 Prozent Anteil1 an der inländischen Bruttowertschöpfung stellt einen
wichtigen Teil der Volkswirtschaft dar. Gegenüber anderen Wirtschaftszweigen weist
das Baugewerbe jedoch einen signifikant geringeren Produktivitätszuwachs aus (Abbil-
dung 1). Die Planungsbranche verzeichnet gar eine rückläufige Tendenz.
Abbildung 1: Arbeitsproduktivität in drei ausgewählten Branchen
Eine Studie am 'Center for Integrated Facility Engineering' (CIFE) an der Universität
Stanford kam zum Schluss, dass die Baubranche in den USA sogar während der letzten
40 Jahren praktisch keinen nachweisbaren Zuwachs an Produktivität verzeichnete2. Die
Gründe hierfür sind vor allem in den relativ kleinen und wenig spezialisierten Planungs-
1 Quelle: Bundesamt für Statistik BfS: Bruttowertschöpfung nach A6 Branchenaufteilung2 Vgl. Eastman et al. (2008), S. 8 ff.

Einleitung 2
——————————————————————————————————————————
büros zu suchen. Ebenso Schuld für die geringe Produktivität trägt die Tatsache, dass in
der Planungs- und Baubranche wenig in Forschung und Entwicklung investiert wird,
was nicht zuletzt zu arbeitsintensiven und produktivitätshemmenden Prozessen führt.
Der vermehrte Arbeitsaufwand wird auf den Baustellen nicht zwingend durch den ver-
mehrten Einsatz rationeller Techniken und Methoden bewerkstelligt, wenn billige Ar-
beitskräfte (aus andern Ländern) zur Verfügung stehen.
Verglichen mit andern Branchen befindet sich die Bau- und Planungsbranche bezüglich
Marktattraktivität und Wettbewerbsposition abgeschlagen im hintern Mittelfeld (Abbil-
dung 2).
Abbildung 2: Längerfristige Branchenpositionierung (UBS Outlook Q1/2009)
Mit der geringen Arbeitsproduktivität und der tiefen Marktattraktivität einher geht die
Tatsache, dass der ursprünglich als Generalist ausgebildete Architekt heute als Dienst-
leister am Kunden gemessen am Gesamtprozess eine immer kürzere Phase bearbeitet.
Das Feld des planenden Architekten wird schrittweise besetzt von Projektentwicklern,
Immobilienfachleuten bzw. General- und Totalunternehmern. Für den Architekten ist
der kleiner werdende Anteil am gesamten Wertschöpfungsprozess die unausweichliche
Folge.

Einleitung 3
——————————————————————————————————————————
Trotz dieser eher pessimistischen Schilderung der Ausgangslage gibt es auch interessan-
te und viel versprechende Ansatzpunkte, wie Architekten den neuen Herausforderungen
begegnen können. Diese werden im Kapitel 3 eingehend beschrieben.
1.2 Zielsetzung
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, den heutigen Stand der Dinge bezüglich des Ein-
satzes digitaler Hilfsmittel in Architekturbüros aufzuzeigen. In einer ersten Phase wird
versucht, das weite Feld der heute möglichen Computereinsätze in der Bauplanung aus
der Sicht des planenden Architekten abzustecken und nach dem Grad der Digitalisie-
rung zu hierarchisieren; sozusagen vom Tuschestift bis zur vollständig digitalisierten
Planung mittels 4D-Design. Das Phänomen der Rationalisierung und Optimierung des
Planungsablaufes bildet die wirtschaftstheoretische Grundlage und Triebfeder der Über-
legungen.
In einer zweiten Phase wird mit einer aussagekräftigen Stichprobenanalyse ermittelt, in
wie weit Schweizer Architekturbüros von Computern Gebrauch machen in ihrer tägli-
chen Arbeit. Anhand von präzisen Fragestellungen soll der Grad der Digitalisierung der
befragten Büros bestimmt werden.
Die dritte Phase setzt sich mit der Diskrepanz zwischen den beiden Zuständen 'möglich'
und 'ist' auseinander. Es soll einerseits aufgezeigt werden, wo die Schweizer Architek-
turbüros hinsichtlich des aktuellen Standes des technisch Möglichen stehen, andererseits
soll das Potenzial sichtbar gemacht werden, wohin sich die Planung in den nächsten
Jahren entwickeln kann bzw. wird.
Ähnliche Untersuchungen3 u.a. in Skandinavien dienen dazu, den Stand der Digitalisie-
rung der Schweizer Architekturbüros ansatzweise auch in einem internationalen Rah-
men zu vergleichen.
1.3 Arbeitshypothesen
Die wenig verheissungsvolle Schilderung der Ausgangslage soll als Grundlage für die
hier folgenden Arbeitshypothesen verstanden werden. Der Planungs- und Baubranche,
insbesondere den Architekturbüros von heute, wird aus noch näher zu beleuchtenden
Gründen eine Art grundlegende Resistenz gegenüber neuen Technologien und Arbeits-
weisen unterstellt. Viele kleine Architekturbüros fokussieren sich zu sehr auf den Pro-
jektinhalt bzw. auf die an sich lobenswerte Fähigkeit, mit dem eigenen Entwurf einen
kulturellen Beitrag zu leisten. Die Strukturierung der eigenen Arbeit, das Know-How ei-
3 Vgl. Kapitel 1.5

Einleitung 4
——————————————————————————————————————————
nes optimierten und koordinierten Projektablaufes mit allen beteiligen Planern bleibt oft
zweitrangig. Aus eigener Erfahrung kann hier erwähnt werden, dass nicht nur kleine Bü-
ros von dieser 'Technikabstinenz' gekennzeichnet sind; ebenso hinken grössere und be-
kannte Büros oftmals dem Stand der Technik hinterher. Folgende drei Arbeitshypo-
thesen dienen als Leitlinien der vorliegenden Arbeit:
Hypothese 1: Schweizer Architekturbüros benutzen das Arbeitsmittel des Computers le-
diglich als digitales Zeichenbrett für die Erstellung von zweidimensionalen Vektorplä-
nen und ignorieren dabei die potentiellen Möglichkeiten, wie man die Rechner sonst
noch einsetzen könnte.
Hypothese 2: Dreidimensionale Gebäudemodelle sind zwar bekannt, werden aber nicht
in grossem Umfang eingesetzt, da sie letztlich in der konventionellen Bauplanung nicht
direkt umgesetzt werden können.
Hypothese 3: Die durchgehende digitale Planung mittels 'Building Information Mode-
ling' (BIM) oder 4D-Design ist in den Schweizer Architekturbüros praktisch unbekannt
und nicht verbreitet.
Die in Kapitel 4 folgenden qualitativen und quantitativen Analysen sollen mithelfen, die
hier als Vermutung in den Raum gestellten Hypothesen zu beweisen bzw. zu wider-
legen.
1.4 Vorgehensweise und Methodik
Anhand von Gesprächen, Recherchen und persönlicher Erfahrung werden in einer ers-
ten Phase alle für die Arbeit des Architekten möglichen Einsatzarten von Computern
aufgezeigt. Danach werden diese ihrem 'Grad der Digitalisierung' nach hierarchisch ge-
ordnet.
Die wissenschaftliche Methode des klassischen Empirismus, die Induktion4, wird in ei-
ner zweiten Phase angewendet. Eine Online-Umfrage bei einer noch zu bestimmenden
Anzahl von Architekturbüros soll eine genügend sichere Aussage zulassen, so dass auf
eine Tendenz in der Gesamtheit der Büros geschlossen werden kann. Der dem Empiris-
mus immanenten Unsicherheit des Induktionsschlusses wird mit einer möglichst breit
abgestützten und repräsentativen Umfrage begegnet. Neben der quantitativen Analyse
ergänzen Interviews mit ausgewählten Büros als qualitativer Beitrag den Analyseteil.
4 Vgl. Bortz / Döring (2006), S. 300 ff.

Einleitung 5
——————————————————————————————————————————
Das gewonnene Datenmaterial wird zur Verifikation bzw. zur Falsifikation der vorher-
gehend aufgestellten Arbeitshypothese eingesetzt. Im Wissen um die Limiten der Me-
thode der Induktion5 wird trotzdem versucht, mit Hilfe der gewonnen Erkenntnis einen
Ausblick in die Zukunft des Planungsmetiers im Allgemeinen und des Berufsbildes des
Architekten im Speziellen zu wagen.
1.5 Vergleichbare Untersuchungen
Die Frage nach dem Gebrauch von Informationstechnik im Planungs- und Baubereich
war Gegenstand mehrerer grösserer Erhebungen während der letzten ca. 10 Jahre. Sie
werden an dieser Stelle lediglich kurz erwähnt. Die daraus gewonnene Erkenntnis wird
später im Kapitel 5 zusammen mit den in der Schweiz analysierten Daten näher be-
leuchtet:
Rob Howard, Arto Kiviniemi und Olle Samuelson untersuchten in ihrem erstmals 1998
publizierten 'Survey of IT in the Construction Industry and Experience of the IT Baro-
meter in Scandinavia'6 den Einsatz von Computern in den fünf Berufsfeldern Architekt,
Ingenieur, Bauunternehmer, Gebäudemanagement und Andere. Die Untersuchungen
wurden in Dänemark, Finnland und Schweden durchgeführt mit dem Ziel, die Daten in
einem internationalen Rahmen vergleichen zu können. Sie wurden im Abstand von eini-
gen Jahren wiederholt und erlauben somit repräsentative Aussagen und Prognosen über
den IT-Einsatz und dessen Entwicklung in der Bau- und Planungsbranche in den er-
wähnten Ländern.
Insgesamt wurde der 'IT-Barometer Survey' in Skandinavien dreimal durchgeführt
(1998, 2000 und 2007)7. Alles in allem zeigen die drei genannten Untersuchungen einen
klaren Trend zu vermehrtem Einsatz von Computer, Netzwerken und neuen digitalen
Technologien in der Planungs- und Baubranche auf. Die immer billiger und schneller
werdende Hardware wie auch die technologische Entwicklung in der Gesellschaft als
Ganzes beschleunigen den Prozess. Dank dem Internet ist es möglich, immer schneller
und von den unterschiedlichsten Orten aus auf die gewünschten Informationen zuzu-
greifen. Erst in den letzten Jahren jedoch wurden vermehrt Technologien eingesetzt wie
'Product Models' oder 'Building Information Modeling' (BIM). Ein klarer Trend ist fest-
stellbar, weg von der reinen Geometrie der Modelle, hin zu 'intelligenten, objektbasie-
renden Modellen'.
5 Vgl. Taleb (2008), S. 61 ff.6 Vgl. Howard et al. (1998)7 Vgl. Samuelson (2002) und Samuelson (2008)

Einleitung 6
——————————————————————————————————————————
Das in den nordischen Staaten entwickelte Konzept des 'IT-Barometer Survey' wurde
2003 von Hua Bee Goh in ähnlichem Sinne in Singapur eingesetzt (IT-Barometer 2003:
Survey of Singapore Construction Industry and a Comparison of Results)8. Weitere teils
sehr ähnliche Untersuchungen wurden in Kanada9, in der Türkei10, in Jordanien11 und in
Nigeria12 durchgeführt.
1.6 Thematische Abgrenzung
Trotz des Interesses und der Wichtigkeit des Themas wird es im begrenzten Rahmen
dieser Arbeit nicht möglich sein, das 'IT-Barometer' im Sinne der erwähnten Beispiele
für die Schweiz zu eruieren – es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die ge-
nannten Untersuchungen jedoch sollen als Grundlage für die Formulierung der relevan-
ten Fragen dienen, auch im Hinblick auf eine mögliche internationale Vergleichbarkeit
bezüglich des IT-Einsatzes.
Des Weiteren beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf das Tätigkeitsfeld des Archi-
tekten. Die zum Verständnis der Rolle des Planers notwendige Betrachtung der ver-
wandten Bereiche wie z.B. Bauingenieure, HLKKS-Ingenieure oder das Facility Mana-
gement werden nur soweit nötig mit in die Analyse einbezogen, als sie der zu Beginn
formulierten Frage nach dem Digitalisierungsgrad von Schweizer Architekturbüros die-
nen.
8 Vgl. Goh (2004)9 Vgl. Rivard (2000)10 Vgl. Tas (2007)11 Vgl. El-Mashaleh (2007)12 Vgl. Oladapo (2007)

Theoretische Grundlagen 7
——————————————————————————————————————————
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Die Bauplanung im immobilienwirtschaftlichen Kontext
Zum besseren Verständnis der Rolle der Planung von Gebäuden wird zunächst deren
Positionierung im Universum der Immobilienwirtschaft näher beleuchtet. Anhand von
zwei Modellen soll die Arbeit der Bauplanung im ökonomischen Kontext eingebettet
werden.
Im von Prof. Dr. Karl-Werner Schulte entwickelten 'Haus der Immobilienökonomie'13
(Abbildung 3) ist ersichtlich, dass das Planen und Bauen je länger je mehr geprägt wird
von einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Während der Architekt im frühen Mittel-
alter als alleiniger Werkmeister, 'magister operis' genannt, ganze Bauwerke nach seinen
Plänen und Schablonen errichten liess14, beeinflussen heute viele artverwandte Fachge-
biete die Planung von Gebäuden. Technische Anforderungen wie Tragwerkslehre,
HLKKS, Bauphysik, Geologie etc. müssen ebenso unter einen Hut gebracht werden wie
die Erfüllung aller rechtlichen Vorschriften (Baurecht, Regeln der Baukunst etc.). Da ein
Gebäude oft einige Jahrzehnte bis Jahrhunderte unsere Umwelt prägt, sind zudem auch
längerfristige Aspekte wie städtebauliche Zusammenhänge in der architektonischen Ar-
beit zu berücksichtigen.
Abbildung 3: Haus der Immobilienökonomie (nach Prof. Dr. Karl-Werner Schulte)
Das Berufsverständnis des heute planenden Architekten erstreckt sich somit vom sim-
plen Erfüllen von technischen, rechtlichen und letztlich auch finanziellen Bedingungen
13 Vgl. Schulte (2005)14 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 33 ff.

Theoretische Grundlagen 8
——————————————————————————————————————————
bis zum interdisziplinär arbeitenden Generalisten, welcher sich verantwortungsbewusst
und nachhaltig mit der gebauten Umwelt auseinandersetzt und dies über den ganzen Le-
benszyklus der Baute.
Betrachtet man die 'klassischen' Phasen einer Immobilie, so folgen nach der Projektent-
wicklung die Planung und der Bau; diese werden von der Bewirtschaftung abgelöst. Der
zunehmende Zeitdruck in der Planung führt jedoch oftmals zu überschneidenden Pha-
sen, insbesondere zwischen Planung und Bau, meist in Form einer „rollenden Planung“.
Wie später noch genauer erläutert wird15, erhalten heute Architekten aus vor- und nach-
gelagerten Bereichen Konkurrenz. Die Eigentümer, aber auch Projektentwickler, erwei-
tern ihr Betätigungsfeld um Bereiche wie strategische Planung oder Vorstudien. Nach-
gelagert versuchen die Gebäudeersteller (Total-, bzw. Generalunternehmer) möglichst
früh ihre Dienstleistung an den Mann bzw. an den Auftraggeber zu bringen, was insbe-
sondere bei einer phasenübergreifenden ('rollenden') Planung Konfliktpotential mit den
Architekten mit sich bringt.
Im gesamten Prozess der Immobilienökonomie hat die Planung von Gebäuden den Cha-
rakter einer Dienstleistung. Der Auftraggeber bestellt beim Architekten die Planung
bzw. das komplette Werk. Die Zusammenarbeit erfolgt objektbezogen und weist gene-
rell wenig strategiebezogene Aspekte auf. Vorstellbar wäre jedoch auch ein vermehrter
Miteinbezug der Planung in die Immobilienstrategie, beispielsweise ein Immobilien-
portfolio, bestehend aus durchgängig digitalisierten Gebäuden, oder ein Portfolio aus
Immobilien, welche explizit nicht in hierarchisch organisierten Planungsstrukturen und
Prozessen entstanden sind, sondern von Planungsnetzwerken erzeugt worden sind.
Währenddem das „Haus der Immobilienökonomie“ die Struktur des Immobilienuniver-
sums aufzeigt, erklärt folgende Darstellung (Abbildung 4) des 'Real Estate Systems'16
die Funktionen der einzelnen Akteure in den Bereichen 'Space und Asset Market' sowie
der 'Development Industry'. Dem Bereich der Bauplanung als ausführendem Arm der
'Development Industry' kommt die Rolle zu, dem Gebäudebestand neue Objekte hinzu-
zufügen, falls sich die Entwicklung neuer Projekte als profitabel erweist. Massgebend
hierfür sind der vom Mieter generierte Cash-Flow und die Kapitalkosten, welche sich
im Ertragswert widerspiegeln. Zusätzlich braucht es eine gewisse Voraussicht seitens
der Projektentwickler, da sich einerseits die nationale und internationale Konjunktur an
gewisse Rhythmen hält und andererseits eine Immobilie (noch) nicht von heute auf
morgen hergestellt werden kann, das heisst, eine gewisse Bauzeit benötigt.
15 Siehe Kapitel 3.1 und 3.216 Vgl. Geltner / Miller (2007), S. 23

Theoretische Grundlagen 9
——————————————————————————————————————————
Abbildung 4: The Real Estate System (nach Kanak Patel)
Auf der einen Seite erfüllt der Architekt also den immobilienwirtschaftlichen Anspruch
an die Bauplanung bzw. an die Erstellung von Architektur. Gleichzeitig ist der Architekt
jedoch heute mehr als nur der technische Erfüllungsgehilfe des Investors. Nicht verges-
sen werden darf, dass das Bauwerk für einen kulturellen Beitrag unserer Zeit steht, oder
ausgedrückt mit den Worten von Ernst Bloch: 'Architektur ist und bleibt ein Produkti-
onsversuch von menschlicher Heimat'17.
2.2 Rationalisierung aus wirtschaftstheoretischer Sicht
Die Frage nach den Beweggründen, welche Unternehmen veranlassen, vermehrt digitale
an Stelle von analogen Hilfsmitteln einzusetzen, führt zur Betrachtung grundlegender
betriebswirtschaftlicher Phänomene wie Rationalisierung oder Automation. Unter Ra-
tionalisierung versteht man in einem wirtschaftlichen Sinne die Steigerung der Effizienz
durch das bessere Ausnutzen der sich bietenden Möglichkeiten18. So kann ein Effekt mit
weniger Ressourcen oder mit den gleichen Ressourcen ein höherer Effekt erzielt wer-
den.
Eine mögliche Umsetzung dieses Prinzips ist das Optimieren von Betriebsabläufen. Der
Amerikaner Frederick Winslow Taylor untersuchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach
wissenschaftlichen Kriterien, wie man Betriebe nach dem oben genannten Prinzip opti-
mieren konnte. In seiner eher mechanistischen Sicht verglich er das Unternehmen mit
einer Maschine, wobei die Arbeiter als deren Rädchen betrachtet wurden. Beispiels-
weise ermittelte er mit dem sog. Schaufelgrössenexperiment das optimale Gewicht einer
Schaufelladung eines schaufelnden Menschen19. Gemäss den Untersuchungen Taylors
17 Vgl. Bloch (1985)18 Vgl. Pfeiffer (1993), 3. Bd., S 3939 ff.19 Vgl. Hebeisen (1999), S. 73 ff.

Theoretische Grundlagen 10
——————————————————————————————————————————
basiert der Erfolg eines Unternehmens auf einfachen Prinzipien wie hohe Arbeitstei-
lung, präzise Anleitungen und Geld als Motivationsfaktor. Henry Ford setzte die Prinzi-
pien Taylors mit der Einführung der Fliessbandproduktion für sein Modell T äusserst
konsequent um. Charlie Chaplin setzte mit seinem Film 'Modern Times' der sehr mecha-
nistisch verstandenen Betriebs- und Geschäftsführung nach Taylor (Taylorismus) ein ci-
neastisches Denkmal.
Die Konzepte Taylors und die Umsetzungen Fords waren die optimale Antwort der Be-
triebe auf die Rahmenbedingungen der Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Heute, hundert Jahre später, sind es die Konzepte des 'Lean Managements', welche ähn-
lich wie damals, durch fundamental neue Denkweisen optimale Antworten auf betriebli-
che Probleme liefern können20. Das Prinzip des 'Lean Managements' wurde am konse-
quentesten im Unternehmen Toyota umgesetzt. Als sein Erfinder und Promotor gilt Taii-
chi Ohno, zuerst Betriebsingenieur, zuletzt Vizepräsident der Toyota Motor Company.
Toyota rückte erstmals in den 80er Jahren ins Blickfeld, u. a. durch die Analysen und
Vorträge von W. Edwards Deming. Japanische Autos hatten damals diejenigen der USA
bezüglich Qualität, Lebensdauer und effizienter Fertigung überholt. Und dies trotz oder
vielleicht wegen der Tatsache, dass Japan nach dem zweiten Weltkrieg über keine Hilfe
von aussen verfügte. Der Mangel an Rohstoffen veranlasste die japanischen Ingenieure,
diese möglichst effizient zu nutzen und auch die Prozesse möglichst schlank zu halten.
Der beeindruckende Geschäftserfolg von Toyota beruhte auf dem konsequenten Umset-
zen folgender 14 Prinzipien21:
1. Machen Sie eine langfristige Philosophie zur Grundlage Ihrer Managementent-
scheidungen, selbst wenn dies zu Lasten kurzfristiger Gewinnziele geht. Eine auf
ein gemeinsames Ziel ausgerichtete Organisation, welche das Generieren von Wert
für den Kunden, die Gesellschaft und die Wirtschaft vor Augen hat, soll von verant-
wortungsvollen Leuten geführt werden.
2. Sorgen Sie für kontinuierlich fliessende Prozesse, um Probleme ans Licht zu brin-
gen, denn nur der richtige Prozess führt zu den richtigen Entscheidungen. Ein flies-
sender Prozess bringt Material und Information zum Menschen und hilft mit, Leer-
läufe und Verschwendungen zu beseitigen.
3. Verwenden Sie Pull-Systeme, um Überproduktion zu vermeiden, denn der ver-
brauchsgesteuerte Materialnachschub mit minimalsten Zwischenlagern und fle-
xibler Reaktion auf Kundenwünsche ist das Grundprinzip der 'Just-in-Time-Produk-
tion'.
20 Vgl. Pfeiffer / Weiss (1994), S. 1 ff.21 Vgl. Liker (2008), S. 71

Theoretische Grundlagen 11
——————————————————————————————————————————
4. Sorgen Sie für eine ausgeglichene Produktionsauslastung. Dies bedeutet das Elimi-
nieren nicht werthaltiger Elemente, die Vermeidung der Überlastung von Mensch
und Maschine sowie das Ausbalancieren von ungleichen Produktionsplänen.
5. Schaffen Sie eine Kultur, die auf Anhieb Qualität erzeugt, statt einer Kultur der ewi-
gen Nachbesserung. Mit selbstgesteuerter Fehlererkennung und modernen QS-Me-
thoden ausgestattete Systeme bieten dem Kunden das Maximum an Qualität.
6. Standardisierte Arbeitsschritte sind die Grundlage für die kontinuierliche Verbesse-
rung und die Übertragung von Verantwortung auf die Mitarbeiter. Stabile, wieder-
holbare Methoden und kumulierte Lernerfahrungen sind die Voraussetzung, um
'Best Practices' zum Standard zu erheben.
7. Nutzen Sie visuelle Kontrollen, damit keine Probleme verborgen bleiben. Einfache
visuelle Systeme an den Arbeitsstationen helfen mit, den Prozess im Fluss zu halten.
8. Setzen Sie nur zuverlässige, gründlich getestete Technologien ein, die den Men-
schen und Prozessen dienen. Neue Technologien unterstützen Menschen, sie erset-
zen diese nicht. Bewährte Prozesse sind ungetesteten Technologien bei weitem vor-
zuziehen. Bewährt sich eine neue Technologie im Test, so gilt es, sie schnell umzu-
setzen und in den Prozess zu integrieren.
9. Generieren Sie Mehrwert für Ihre Organisation, indem Sie Ihre Mitarbeiter und Ge-
schäftspartner entwickeln. Im eigenen Betrieb entwickelte Führungskräfte, die alle
Arbeitsabläufe genau kennen, die die Unternehmensphilosophie vorleben und sie
andern vermitteln, sind externen Führungskräften vorzuziehen.
10. Entwickeln Sie herausragende Mitarbeiter und Teams, die der Unternehmensphilo-
sophie folgen. Basierend auf einer starken und stabilen Kultur, in der die Unterneh-
menswerte von allen geteilt werden, nutzen interdisziplinäre Teams die Instrumente
des Unternehmens, um das Unternehmen zu verbessern.
11. Respektieren Sie Ihr ausgedehntes Netz an Geschäftspartnern und Zulieferern, in-
dem Sie sie fordern und dabei unterstützen, sich zu verbessern. Sie sind der verlän-
gerte Arm ihres Unternehmens.
12. Die kontinuierliche Lösung der Problemursachen ist der Motor für organisations-
weite Lernprozesse. Machen Sie sich ein Bild von der Situation, um sie umfassend
zu verstehen. Die Ursache der Probleme zu erkennen und sich persönlich zu infor-
mieren ist besser, als sich auf Informationen aus zweiter Hand oder auf Computer-
analysen zu verlassen.

Theoretische Grundlagen 12
——————————————————————————————————————————
13. Treffen Sie Entscheidungen mit Bedacht und nach dem Konsensprinzip. Wägen Sie
alle Alternativen sorgfältig ab, aber setzen Sie die getroffenen Entscheidungen zü-
gig um.
14. Werden Sie durch unermüdliche Reflexion und kontinuierliche Verbesserung zu ei-
ner wahrhaft lernenden Organisation. Stabile, aber kontinuierlich sich verbessernde
Prozesse, das Vermeiden von Lagerbeständen und sonstiger Verschwendungen und
der Schutz des institutionellen Wissens einer stabilen Belegschaft sind die Grundla-
ge einer erfolgreichen und verantwortungsvollen Unternehmung.
Des weiteren ist hier festzuhalten, dass das Toyota-Produktionssystem (TPS) kein Werk-
zeugkasten ist, bestehend aus einzeln anzuwendenden Instrumenten. Das TPS ist ein
hoch entwickeltes Produktionssystem, in dem alle Elemente zu einem reibungslos funk-
tionierenden Ganzen zusammenwirken22.
Eine weitere Umsetzungsmöglichkeit des Prinzips der Rationalisierung ist der vermehr-
te Einsatz von Maschinen an Stelle der menschlichen Arbeitskraft. Unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten kann eine Maschine eine höhere Wertschöpfung haben als eine
menschliche Arbeitskraft, wenn der Output der Maschine höher ist als derjenige des
Menschen, bzw. wenn die Kosten pro maschinell hergestellter Einheit tiefer sind als
jene der von Hand hergestellten.
Das Ersetzen der menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen und somit das Erzielen ei-
ner höheren Wertschöpfung und einer höheren Produktivität galt insbesondere während
der vergangenen 200 Jahre als Maxime wirtschaftlichen Handelns. Gemäss dem US-
Ökonomen Jeremy Rifkin befinden wir uns heute nach der ersten Revolution (Ersatz der
menschlichen und tierischen Arbeitskraft durch den Primärenergieträger Kohle) und der
zweiten (Ersatz der Kohle durch Öl) in der dritten, digitalen Revolution, welche durch
die neue Arbeitskraft des Computers gekennzeichnet ist23. Seiner Ansicht nach wird uns
durch die digitale Revolution längerfristig die Arbeit ausgehen, da selbst die billigste
menschliche Arbeitskraft teurer ist als eine Maschine. Massgeblich verantwortlich für
diese dritte 'Revolution' sind die Erfindung des Mikrochips und dessen kontinuierliche
Steigerung der Leistung (gemäss dem 'Mooreschen Gesetz' verdoppelt sich die Leistung
der Mikrochips alle zwei Jahre). Mit der Computerisierung in den 80er Jahren wurden
die Geräte nun auch für private Konsumenten erschwinglich und setzten sich nach und
nach in praktisch allen Arbeitsgebieten durch. Heute werden die Computer als selbstver-
ständliches Arbeitsmittel betrachtet.
22 Vgl. Liker (2008), S. 6723 Vgl. Rifkin (2001), S. 47 ff.

Theoretische Grundlagen 13
——————————————————————————————————————————
Beide erwähnten Möglichkeiten der Rationalisierung das Optimieren der Prozesse im
Sinne von Toyotas Modell der 'Lean Production' wie auch das zunehmende Ersetzen der
menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen und Computer gelten auch in weiten Teilen
für die Baubranche. Die Anforderungen auf der Baustelle sind zwar nicht 1:1 vergleich-
bar mit Produktionen in der Fabrik. Baustellen sind in der Regel komplexe und einmali-
ge Produktionsanlagen von Prototypen. Sie sind wegen Witterungsabhängigkeit, lokalen
Bedingungen und ständig wechselnden Unternehmern aufwändiger als die stationäre
Produktion in der Fabrik. Trotzdem haben einige Unternehmer die mangelnde Wert-
schöpfung auf der Baustelle erkannt und orientieren sich immer häufiger an den oben
genannten Prinzipen von Toyota. Auf der Baustelle haben neue Konzepte wie die 'Lean
Construction'24, eine Adaptation des Toyota-Produktionssystems auf die Bauwelt, schon
teilweise Einzug gehalten, insbesondere im Stahl- oder Holzbau oder in der Fabrikation
von Fertigelementen wie Betonfertigteilen, Türen oder Fenstern.
In der Planung sieht es jedoch anders aus. Verglichen mit der Arbeitsweise von vor eini-
gen Jahren und Jahrzehnten haben die Planer zwar den Tuschestift längst gegen die
Computermaus eingetauscht. Der Computer wird jedoch oft noch lediglich als dessen
Ersatz, als neues Werkzeug angesehen. Die Prozesse sind vielerorts immer noch diesel-
ben wie vor dem digitalen Wandel. Fliessende Prozesse, Pull-Systeme oder standardi-
sierte Arbeitsschritte sind in vielen Planungs- und insbesondere Architekturbüros immer
noch Fremdwörter. Im besten Fall wird unter dem Begriff 'langfristige Philosophie'
(Prinzip 1 des TPS) eine architektonische oder städtebauliche Haltung verstanden, in
seltenen Fällen eine Firmenphilosophie. Ebenso entsprechen die relativ hohen Fluktua-
tionen in den Architekturbüros wie auch die oft projektbezogen eingesetzten Mitarbeiter
nicht den Prinzipien der 'Stabilen Belegschaft' (Prinzipien 10 und 14). Würden vermehrt
standardisierte Arbeitsschritte und gründlich getestete Technologien (Prinzipien 6 und 8)
eingesetzt, gäbe es weniger Bauschäden auf Grund von Planungsfehlern.
Aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit Kollegen kann hier festgehalten werden,
dass es bei den Architekten heute meist immer noch darum geht, den (unwissenden)
Bauherrn von der eigenen Lösung und den bekannten (aber nicht effizienten) Arbeits-
weisen zu überzeugen. Oft wird das geplant und hergestellt, was man gelernt hat und
was man kann, was nicht mit dem übereinstimmen muss, was der Kunde wünscht. Ein
Beispiel ist der nicht sonderlich effiziente Umweg über den zweidimensionalen gezeich-
neten Plan und dies, obwohl der Auftraggeber nicht den Plan, sondern das Bauwerk be-
stellt hat.
24 Vgl. Ballard et al. (2002), S. 227 ff.

Theoretische Grundlagen 14
——————————————————————————————————————————
2.3 Entwicklung des Computers als Wegbereiter neuer Arbeitsmethoden
Ein kurzer geschichtlicher Rückblick zeigt, dass der Beruf des Architekten gar noch
nicht so alt ist. In Zünften und Bauhütten organisierte Handwerker waren im Mittelalter
verantwortlich für das Erstellen von kleinen wie auch grossen Bauten. Das Planen als
eigenständige Disziplin existierte noch nicht. Die erworbenen Kenntnisse um das Bauen
wurden von Generation zu Generation in Schwurgemeinschaften weitergegeben. Viele
der damals erstellten Bauten waren im heutigen Sinne 'nicht geplant' bzw. wurden ex-
plizit nicht 'entworfen'. Das Gebäude war das Resultat der auf klaren Regeln basieren-
den Arbeit von Maurern, Zimmerleuten, Schreinern etc.. Zur Errichtung von grösseren
Bauten wie z.B. Kirchen wurde der geplante Grundriss oft direkt auf den Boden 'geris-
sen', das heisst gezeichnet; er diente dann den Handwerkern als Richtschnur für das dar-
auf zu erstellende Gebäude diente25.
Erst während der kulturellen Umbrüche der Renaissance änderte sich die Lage. Man be-
gann, unter anderem auch dank wohlhabender Monarchen und anderer Mäzene, die ei-
gentliche Konstruktion von einem Gebäude von der dahinter liegenden Absicht bzw. der
Idee (nach Platon) zu trennen. Losgelöst von den materiellen Bedingungen wurden
ideale, d.h. für die damalige Zeit, auf klassischen griechisch-römischen Vorbildern ba-
sierende Bilder gesucht (siehe Abbildung 5).
Abbildung 5: Prospettiva di Città ideale (ca. 1470)
Das Trennen der übergeordneten Idee vom nachher tatsächlich physisch existierenden
Gebäude bedingte neue Informationsträger. Erstmalig wurden während der Renaissance
massstabsgetreue Modelle zur Überprüfung des Entwurfes erstellt. Zweidimensionale
Pläne stellen ein Abbild des Gebäudes in Form von Grundrissen, Schnitten, wohl pro-
portionierten Ansichten und der neu entdeckten Darstellungsart der Perspektive dar. Sie
dienten als Kommunikationsmittel zwischen dem Projektverfasser und den Bauleuten,
welche für die Ausführung zuständig waren. Die Ausbildung des so neu entstandenen
Berufes des Architekten, welcher gesellschaftlich sehr geachtet wurde, konzentrierte
sich auf das Planen der Bauten, konkret auf das Erstellen von Plänen und Modellen.
25 Vgl. Kalay (2004) S. 7

Theoretische Grundlagen 15
——————————————————————————————————————————
Der Prozess der Planung beruht heute immer noch auf ähnlichen Abläufen wie damals.
Nach einer grundlegenden Analyse werden in einem intuitiven und iterativ geprägten
Ablauf alle verschiedenen Entwurfsfaktoren (Form, Licht, Material, Ausrichtung, Struk-
tur, etc.) fein zueinander abgewogen und zu einer Synthese gebracht. Diese wird ansch-
liessend anhand rationaler Kriterien evaluiert und gegebenenfalls wieder in den Ent-
wurfsprozess zurückgeführt.
Im Zuge des Einsatzes der ersten grösseren Rechneranlagen wurden den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts erstmalig CAD-Programme eingesetzt. Am MIT in Boston zeigte Ivan
Sutherland 1963 im Rahmen seiner Dissertation, dass es mit seinem neu entwickelten
Programm Sketchpad möglich ist, an einem umgebauten Radarschirm mit einem Licht-
stift einfache Zeichnungen zu erstellen26. 1965 entwickelte der amerikanische Flug-
zeughersteller 'Lockheed' ein erstes kommerzielles CAD-System zur Herstellung techni-
scher 2D-Zeichnungen. Das System basierte auf damaligen IBM-Grossrechnern und
war mit hohen Kosten verbunden. Das heute erhältliche 3D-CAD Programm CATIA ba-
siert auf dem von 'Lockheed' entwickelten Programm CADAM (Computer Augmented
Design And Manufacturing) und einem ebenfalls Ende der 60er Jahre vom französi-
schen Flugzeughersteller 'Avions Marcel Dassault' entwickelten Grafikprogramm zur
Erstellung von technischen Zeichnungen. Der Architekt Frank Owen Gehry verwendete
die 3D-Funktion des Programmes CATIA Ende der 80er Jahre erstmalig zur Planung
seiner aus Freiform-Flächen zusammengesetzten Skulptur 'Barcelona Fish'27. Ohne
Computer wäre diese Skulptur mit zweidimensionalen Planungsinstrumenten nicht oder
zumindest nur mit einem sehr grossen Aufwand planbar gewesen.
Generell kann die Entwicklung von CAD-Systemen in den 70er Jahren in zwei ver-
schiedene Bereiche unterteilt werden. Einerseits in geometrische Modellierungen für
Applikationen technischer Art wie Flugzeug- oder Automobilbau. Anderseits kamen in
dieser Zeit die ersten CAD-Programme zur Planung von Gebäuden auf. Diese erste Ge-
neration von CAD-Programmen benötigte jedoch noch sehr teure und voluminöse
Grossrechner und spezielle Eingabegeräte wie Grafiktabletts.
Mit dem Aufkommen der ersten Heimcomputer in den 80er Jahren mit neuen und preis-
werten Eingabegeräten wie der Maus kamen auch neue CAD-Programme auf den
Markt. Das erfolgreichste war AutoCAD®, welches auf verschiedenen Betriebssystemen
funktionierte. Das als 'neutrale' Export- und Importschnittstelle konzipierte Dateiformat
DXF setzte sich danach allmählich als Standard-Format durch. AutoCAD® funktionierte
zu Beginn lediglich als zweidimensionales Zeichnungswerkzeug, mit welchem saubere
und präzise Pläne erstellt und wieder abgeändert werden konnten. Die Einführung des
26 Vgl. Kalay (2004), S. 65 ff.27 Vgl. Lindsey (2001), S. 32 ff.

Theoretische Grundlagen 16
——————————————————————————————————————————
Macintosh-Computers 1984 mit seinen grafikorientierten Eingabefunktionen ermöglich-
te die Anwendung von leicht zu erlernenden CAD-Programmen wie MiniCAD® oder
MacDraft®. Die zunehmende Leistungsfähigkeit bei sinkendem Preis machte es nun
auch für kleine Firmen möglich, CAD-Programme und die dazu passende Hardware zu
erwerben. Mitte der 80er Jahre kamen erste Farb-Renderer auf den Markt, mit welchen
es gelang, vektororientierte Zeichnungen in pixelorientierte Bilder umzurechnen. Ty-
pisch für diese zweite Generation von CAD-Systemen sind 2D-Zeichnungen und 3D-
Modellierungen, jedoch auch die Tatsache, dass die Programme sehr generell ausgelegt
waren. Sie versuchten insbesondere, alle grafischen Bedürfnisse der Benutzer abzude-
cken, dies auf Kosten der analytischen und objektorientierten Fähigkeiten, welche erst
zu ihrer Entwicklung geführt hatten28.
Die nächste Generation von CAD-Systemen konzentrierte sich weniger auf die Form,
sondern versuchte die Objekte 'intelligenter' zu machen. Einfüsse aus andern Industrie-
bereichen führten dazu, dass 3D-Objekte mit nicht-geometrischen Attributen versehen
wurden, wie beispielsweise Farbe oder Material. Durch das Ausstatten der Objekte mit
diesen neuen Eigenschaften und mit Verweisen zwischen den Objekten (z.B. Veranke-
rung zwischen dem Objekt Wand und dem Objekt Fenster) beginnen sich die CAD-Sys-
teme von der reinen Darstellung zu lösen. Die zwei- oder dreidimensionale Darstellung
eines Projektes ist lediglich ein mögliches Resultat einer Anordnung der 'intelligenten'
Objekte. Das um alle relevanten Eigenschaften ergänzte 3D-Modell wird zum Produkt-
modell, in dem alle produktdefinierenden Informationen abgebildet werden.
Heute ist es möglich, ein Projekt mit sämtlichen relevanten Informationen digital abzu-
bilden und nach zu definierenden Kriterien zu optimieren. Beispielsweise kann dies ein
möglichst effizienter Bauablauf sein (4D-Design) oder ein im Bau und Betrieb energie-
neutrales Gebäude. Viele auf der Baustelle heute anzutreffenden Probleme lassen sich
somit schon früh am digitalen Modell erkennen und eliminieren.
28 Vgl. Kalay (2004) S. 70

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 17
——————————————————————————————————————————
3 Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung
Die Verknüpfung der beiden Bereiche Bauplanung und Computereinsatz wird zuerst an-
hand des klassischen Planungsablaufes nach dem weit verbreiteten Leistungsmodell 95
der SIA (SIA-Norm 112)29 betrachtet. Nach einem kurzen Überblick über die einzelnen
Planungsphasen sollen die heute möglichen und gängigen Einsatzmöglichkeiten von
Computern erwähnt werden. Ein Arbeiten im stillen Kämmerchen ist insbesondere für
den als Generalisten ausgebildeten Architekten heute kaum mehr möglich. Im Kapitel
Schnittstellenproblematik (3.2) sollen die Verbindungen zu den verwandten Bereichen
wie Gebäudestatik, Bewirtschaftung, Gebäudetechnik etc. auf ihre Tauglichkeit zur digi-
talen Zusammenarbeit hin untersucht werden. Nachfolgend werden dann die heute gän-
gigen und möglichen digitalen Einsätze für Architekten in einer noch zu definierenden
Hierarchisierung aufgezählt und anhand von Beispielen erläutert.
Im gesamten Lebenszyklus einer Baute wird für die eigentliche Planung im Verhältnis
zur Nutzungsdauer relativ wenig Zeit (und Kosten) aufgewendet. Nichts desto trotz wer-
den in dieser Zeit die für das Leben des Gebäudes wichtigsten Weichen gestellt. Die zu
Beginn noch hohe Beeinflussbarkeit bei tiefen Kosten geht im Verlauf der Planung rapi-
de zurück (Abbildung 6). Insbesondere nach dem Spatenstich (Baubeginn), wenn nicht
nur die Architekten und Ingenieure an der Arbeit sind, sondern auch ganze Teams von
Unternehmern und Bauarbeitern, gehen die Kosten für (immer noch mögliche, aber teu-
re) Änderungswünschen in die Höhe.
Abbildung 6: Verhältnis von Kosten zu deren Beeinflussbarkeit
29 Siehe auch: <http://www.webnorm.ch/ProduktDetail.aspx?Produkt_ID=5eb22bdb-b1be-4759-8026-42316f38de10>; Abrufdatum: 10.07.2009; 19:00 Uhr.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 18
——————————————————————————————————————————
3.1 Ablauf einer Bauplanung nach SIA 112
3.1.1 Phase 1: Strategische Planung
Die Zeit vor der eigentlichen Gebäudeplanung ist für den gesamtleitenden Architekten
von grosser Bedeutung; dies wird jedoch häufig verkannt. Beim Nachdenken über Sinn
und Zweck einer Baute, bei der Zieldefinition sowie beim anschliessenden Erarbeiten
des Raumprogramms werden für das spätere erfolgreiche Gelingen entscheidende Wei-
chen gestellt. Auf der Basis einer Analyse des Zustandes und der Bedürfnisse aller am
Bauprozess beteiligten 'Stakeholder' wird ein umfassender Überblick der Ausgangslage
sowie aller Rahmenbedingungen gewonnen30. Das anvisierte Ziel des Bauprozesses, das
zu erstellende Gebäude, wird bezüglich Qualität, Kosten, Zeitrahmen, Organisation etc.
phasengerecht umschrieben und allgemeingültig festgelegt. Die gewählte Lösungsstra-
tegie dient als Grundlage für die folgende Phase der Vorstudien.
Die Unterstützung mit digitalen Hilfsmitteln in der Phase der strategischen Planung von
Gebäuden beschränkt sich des Öfteren lediglich auf die sonst in Büros üblichen Arbeits-
instrumente wie Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation. Jedoch werden in dieser
Phase die Weichen gestellt, inwiefern und in welcher Tiefe in der nachfolgenden Pla-
nung Computer eingesetzt werden. Der Entscheid zu Gunsten einer durchgehenden digi-
talen Gebäudemodellierung erfolgt am effektivsten in der Phase der strategischen Pla-
nung. Allerdings erfordert dieser Schritt eine vorausschauende Sicht über die Dinge, wie
auch das Erkennen der Vorteile dieser Strategie.
3.1.2 Phase 2: Vorstudien
Auf den Erkenntnissen der Phase 'strategische Planung' aufbauend wird in der Phase 2
die generelle Machbarkeit eines Projektes geprüft. Im Teilmodul 'Projektleitung'31 gilt
es, die organisatorische Seite der Aktivitäten aufzustellen. Dazu gehören das Zusam-
menstellen und Leiten des Projektteams, die Vorbereitung der Projektorganisation, wie
auch das Konzipieren des Informationsaustausches. Das Teilmodul 'Rahmenbedingun-
gen und Ziele' festigt die vom Auftraggeber kommenden Anforderungen an Nutzung,
Bau, Betrieb, Standard, Gestaltung, Kosten- und Zeitrahmen, etc.. Alle benötigten Pro-
jektgrundlagen (Raumordnung, Erschliessung, Umwelt etc.) werden zusammengetragen
und hinsichtlich ihres Einflusses auf das Projekt bewertet. Im Modul 'Machbarkeitsstu-
die' werden vom Architekten prinzipielle Lösungsansätze aufgezeigt. Sie entlarven zu
optimistische Grundannahmen, beispielsweise hinsichtlich Raumprogramm oder Bau-
30 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 39 - 44 31 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 105 ff.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 19
——————————————————————————————————————————
recht. Ein für die meisten Architekten unsicheres Terrain bildet das Teilmodul 'Finanzie-
rungsstudie'. Die Richtkosten werden über grobe Kostenschätzungen ermittelt, welche
meist auf Vergleichskennzahlen (z.B. Preis pro Kubikmeter Gebäudevolumen oder Qua-
dratmeter Nutzfläche) basieren. Die Ermittlung der Rentabilität und der Wirtschaftlich-
keit ist prägend für den Entscheid für oder gegen eine Planung.
Ein bekanntes Dilemma in frühen Phasen einer Projektierung ist die Tatsache, dass für
die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit und für den Entscheid zur Auslösung einer Pla-
nung Kostenzahlen in einer Genauigkeit benötigt werden, welche jedoch erst nach
Vollendung der Bauaufgabe vorliegen. Finanzstarke Unternehmungen wie General-
oder Totalunternehmer begegnen dem mit der Übernahme des finanziellen Risikos. Al-
lerdings bezahlt der Auftraggeber die so gesicherten Kosten in Form eines Aufpreises.
Kleineren Marktteilnehmern den meisten Architekturbüros also, welche über keine fi-
nanzielle Möglichkeit zur Übernahme von Kostenrisiken verfügen, bleibt einerseits die
Möglichkeit, sich mit Garantiemodellen abzusichern. Durch Beizug einer unabhängigen
Fachstelle, des Garanten, können sich Architekturbüros mit einem Garantievertrag
SIA/BSA gegen Kosten- und Terminüberschreitungen (BKP 1, 2 und 4) sowie nicht ein-
gehaltenen Qualitätsstandard absichern32. Allerdings erfordert dieser Garantievertrag ein
bewilligtes Projekt mit einem präzisen Kostenvoranschlag (Phase 3.2). Eine andere
Möglichkeit, ein Projekt schon in einer sehr frühen Phase mit konkreten Kosten zu bele-
gen, sind eine durchgehende Modellierung des Projektes und das Hinterlegen der Ob-
jekte mit gültigen Kostenzahlen.
Neben den praktisch überall anzutreffenden 'Büroprogrammen' wie Textverarbeitung
oder Tabellenkalkulation beginnt in der Phase Vorstudien in den meisten Büros der Ein-
satz architektenspezifischer Werkzeuge. Oft dienen sauber in Layern strukturierte, zwei-
dimensionale Datenfiles vom Geometer als Basis für Machbarkeitsstudien, die meist als
Flächenschemas angelegt werden (siehe Beispiel in Abbildung 7). Berechnungen aller
Art wie Bewertungen von Grundstücken oder Ertragswertberechnungen mittels der
DCF-Methode können relativ schnell und einfach mit Tabellenkalkulationen erstellt
werden, während das Raumprogramm und die Zieldefinition meist in Textform vorliegt.
In einer frühen Projektphase wird oft unbewusst der Entscheid gefällt, die einzelnen
Projektbereiche wie Wirtschaftlichkeit, Baurecht, Nutzerwünsche oder Architektur mit
jeweils eigenen Werkzeugen zu bearbeiten. Das direkte Darstellen von phasengerechten
Resultaten geht der (längerfristig effizienteren) Verknüpfung der einzelnen Arbeitsmittel
voran.
32 Vgl. Schmid (2007)

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 20
——————————————————————————————————————————
Eine von Anfang an dreidimensional modellierte Machbarkeitsstudie ist aufwändiger zu
erstellen als ein schnell erstelltes Flächenschema, bringt jedoch den Vorteil mit sich,
dass Kostenfolgen von Varianten oder baurechtliche Übertretungen dank direkter Ver-
knüpfung in Echtzeit ersichtlich sind.
Abbildung 7: Beispiel eines schematischen Geschossgrundrisses eines Altersheimes zur Klärung der ge-nerellen Machbarkeit
3.1.3 Phase 3: Projektierung
In der Phase des Vorprojektes und der Konzeptfindung (Phase 3.1) führt die Analyse der
städtebaulichen Situation, der örtlichen und baulichen Vorschriften sowie der Zielvor-
stellungen des Bauherrn zu den Rahmenbedingungen für den Entwurf. Die Grundlagen
der Projektierung und ihre Auswirkungen sind bekannt und in ihrer Wichtigkeit hierar-
chisiert33.
Die Phase des Entwurfes beinhaltet nicht nur die klassische 'Formfindung'. Die Konzep-
te der Nutzung, des späteren Betriebes, der Sicherheit, des Städtebaus, der Ökologie, der
Erschliessung, der Umgebung, des Lärmschutzes, der Gebäudetechnik etc. müssen mit
dem architektonischen Konzept in Einklang gebracht werden. Mit geeigneten methodi-
schen Werkzeugen werden verschiedene Lösungsansätze verglichen und optimiert.
Auch auf intuitivem Wege gefundene Lösungen müssen an klaren Kriterien gemessen
werden. Das Ziel ist die Wahl der optimalen Baulösung in einem konzeptionellen und
umfassenden Sinne. Das Erreichen des Minergie-Standards mit der Wahl der richtigen
Gebäudeform und der Setzung der Öffnungen an der richtigen Stelle gehört ebenso dazu
wie die Rollstuhlgängigkeit aller Räume oder der auf das Konzept hin optimierte Ein-
bau von Lüftungsschächten an geeigneter Stelle. Die Termine sind in Form eines Ab-
33 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 171 ff.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 21
——————————————————————————————————————————
laufprogramms bekannt, die Kosten meist lediglich in Form einer Kostenprognose mit
einer Genauigkeit zwischen ± 10 und ± 25 Prozent, je nach Wahl der Methode.
Zusätzlich zu den in der vorhergehenden Phase erwähnten Einsatzmöglichkeiten von
Computern werden des Öfteren die verschiedenen Lösungsansätze der Phase Vorprojekt
dreidimensional im Computer modelliert und ihre Form auf die Wirkung im Raum hin
untersucht und optimiert. Geht es darum, das Projekt schon in der Phase Vorprojekt zu
vermarkten (Projektwettbewerb etc.), werden die Projektpläne nicht selten ergänzt mit
stimmigen Visualisierungen. Eine wachsende Anzahl darauf spezialisierter Büros ist ge-
übt in der Kunst, selbst ein 'hässliches Entlein' in einen 'schönen Schwan' zu verwan-
deln. Die für Visualisierungen benutzten 3D-Daten werden oft nur für die Bildgenerie-
rung benutzt und selten weiterverwendet.
Der Computer wird jedoch nicht nur als zwei- oder dreidimensionaler Zeichenstift be-
nutzt, es ist auch möglich, ihn zur Generierung von Entwürfen einzusetzen. Beispiels-
weise kann die Maschine eine viel höhere Anzahl von Varianten eines Grundrisses in
nützlicher Frist generieren als der Mensch. Diese Tatsache kann man sich im Feld des
parametrisierten Entwerfens zu Nutze machen, indem man die einzelnen Vorgaben so
einstellt, dass aus einer Grosszahl von Kombinationen eine Anzahl von brauchbaren Va-
rianten resultiert (statistisches Design)34.
Der zweite Teil der Projektierungsphase beinhaltet das Erstellen des Bauprojektes (Pha-
se 3.2). Indem man das Vorprojekt in das Bauprojekt überführt, vergrössert man nicht
nur den Massstab, man präzisiert das Projekt auch inhaltlich und rechtlich. Die nachfol-
gende erstmalige Veröffentlichung des Projektes, die Baueingabe, ist ein rechtlicher und
immobilienwirtschaftlicher Filter im ganzen Bauprozess. Die Projektidee wird in Form
von Projektplänen oft im Massstab 1:100 oder 1:200 ausgearbeitet. Ebenso gilt es, die
technische Gebäudeausrüstung aufeinander abzustimmen. Das zur Bewilligung einge-
reichte Projekt enthält konkrete Angaben zu den Bestandteilen Neubau, Abbruch und
Bestand in einer Genauigkeit von ± 0cm (Abbildung 8). Das geplante Bauvolumen wird
während der öffentlichen Auflage mittels eines Baugespanns markiert.
34 Siehe auch Kapitel 3.6: Computer Aided Architectural Design – Parametrisiertes Entwerfen

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 22
——————————————————————————————————————————
Abbildung 8: Grundrissausschnitt einer Baueingabe mit den üblichen Farben (schwarz: Bestand, rot: Neu, gelb: Abbruch)
Nach der Baueingabe werden die wichtigsten Details in provisorischen Werk- und De-
tailplänen definiert und beschrieben. Die Kosten des Gebäudes werden in den vorherge-
henden Phasen auf Grund von Kennwerten berechnet. Im Bauprojekt ist das Ziel der
Kostenvoranschlag, welcher als detaillierte Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von
± 10 Prozent klassifiziert werden kann35.
Während hierzulande mit Ausnahme der Daten für den Geometer den Behörden prak-
tisch ausschliesslich Papierpläne zur Beurteilung und Bewilligung vorgelegt werden,
können in den USA oder in Skandinavien auf dem IFC-Standard basierende digitale 3D-
Modelle zur Beurteilung von Projekten eingereicht werden. Obwohl die Initiative zu
vermehrtem Einsatz von 'Building Information Modeling' von privater Seite kam, plant,
baut und bewirtschaftet mittlerweile selbst eine wachsende Anzahl von US-Behörden
eigene Bauten mittels digitaler Modellierung36. In den USA oder in Skandinavien hat die
Baueingabe im Sinne einer Veröffentlichung des Projektes jedoch nicht denselben Stel-
lenwert wie hier in der Schweiz, wo das eingegebene Projekt meist eine Kompromisslö-
sung bzw. das Resultat aller am Prozess beteiligten 'Stakeholder' darstellt (Nachbarn,
übergeordnete Verbände etc.).
Die Tatsache, dass in der Schweiz mit ca. 3'000 verschiedenen Bau- und Zonenordnun-
gen keine allgemeingültigen Standards für Messweisen von Gebäuden37 vorliegen und
35 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 24536 Vgl. Sullivan (2007)37 Siehe aktuelle politische Diskussion zur Planungs- und Baugesetzgebung, insbesondere:

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 23
——————————————————————————————————————————
dass die Projekte von den Behörden nur in Papierform akzeptiert werden, kann als gros-
ses Hindernis für einen verstärkten Gebrauch von digitalen Instrumenten in der Bau-
und Planungsbranche gesehen werden. Beispielsweise existieren in den kantonalen Bau-
und Planungsreglementen in der Schweiz sieben unterschiedliche Definitionen des Be-
griffes 'Gebäudehöhe'!
3.1.4 Phase 4: Realisierung
In der Phase der Ausschreibung oder Submission (Phase 4.1) werden die im Bauprojekt
formulierten und gezeichneten Absichten in einzelne Arbeitsgattungen zerlegt, indem
genau beschrieben wird, wer wo und im welchem Ausmass welche Tätigkeiten zu ver-
richten hat. Die Submissionsunterlagen enthalten einen detaillierten und vollständigen
Ausschreibungstext sowie Pläne und Skizzen. Die so definierten Arbeitsschritte werden
dann (öffentlich) ausgeschrieben, bzw. eine Anzahl Unternehmer zur Offertstellung ein-
geladen. Die von den Unternehmern in Konkurrenz gerechneten Kosten werden dann
dem ausschreibenden Büro zum Vergleich weitergeleitet. Nach eingehender Kontrolle
und Vergleichen der Angebote (ev. mit Abgebotsrunden) entscheidet letzlich der Auf-
traggeber über die Vergabe der einzelnen Aufträge. Meist werden die Kosten, insbeson-
dere von grösseren Gewerken (Baumeisterarbeiten etc.) schon vor der eigentlichen Aus-
schreibung mittels Richtofferten eingeholt, mit der Absicht, dank einer frühzeitigen
Kostengenauigkeit, die im KV postulierten Kostenzahlen einhalten zu können. Da die
Unternehmer oft über mehr Know-How in ihrem Gebiet verfügen als der als Generalist
ausgebildete Architekt, fliessen Varianten seitens des Unternehmers in die Ausschrei-
bung mit ein. Die Schwierigkeit für den Architekten besteht dann darin, unterschiedli-
che Varianten für ein Problem vergleichbar zu machen. Bei der Formulierung des Ab-
laufplans ist auf die zeitliche Abfolge und auf allfällige Abhängigkeiten bzw. Wartezei-
ten (z.B. Trocknungszeiten) zu achten.
Der vermasste, zweidimensionale Werk- oder Ausführungsplan bildet als massstabsge-
treues Abbild des späteren Bauwerks oder Gewerkes die wichtigste Grundlage für die
Ausschreibung. Ergänzt wird er mit allfälligen Detailplänen (ebenfalls zweidimensio-
nal), dem Grobterminplan (als Ablaufplan), den einzelnen Leistungsverzeichnissen
(meist in Text- oder Tabellenform), dem Kostenvoranschlag (in Tabellenform) und den
Raumblättern (in Text- und ev. Planform). Der Computer wird also in der klassischen
Submission eingesetzt, um zweidimensionale Pläne zu zeichnen, Termine und Abläufe
aufzuzeigen, Kosten aufzulisten und Leistungstexte zu schreiben38. Im Falle eines nach
'Harmonisierung bei gleichzeitiger Wahrung der Eigenständigkeit' (November 2007); <http://www.irap.ch/fileadmin/user_upload/irap.hsr.ch/Publikationen/Projektberichte/Grundlagen_und_Methoden_der_Raumplanung/pdf_IVHB/2007_11_07_Argumentarium_Harmonisierung_d.pdf>; Abrufdatum 20.06.2009, 19.00 Uhr.
38 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 284

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 24
——————————————————————————————————————————
'bewährter' klassischer Methode arbeitenden Büros sind diese Tätigkeiten nicht logisch
miteinander verbunden. Sie werden als einzelne Werkzeuge eingesetzt, bzw. die logi-
sche Verknüpfung geschieht über den Architekten39, dem Modell fehlt die Konsistenz,
die inhaltliche logische Verbindung.
Der zweite Teil der Realisierung betrifft die Ausführung (Phase 4.2). Das fertig geplante
Gebäude ist bis jetzt lediglich im Kopf des Architekten, selten jedoch komplett digitali-
siert vorhanden. Die Unternehmer mit ihren Arbeitern auf der Baustelle erstellen mit
Hilfe des Werk- oder Ausführungsplanes das von ihnen verlangte Gewerk, während die
Bauleitung den ganzen Ablauf, die Termine, die Kosten, die Abnahmen etc. organisiert
und koordiniert40. Der Werkplan beinhaltet meist die einander überlagerten Daten meh-
rerer Arbeitsgattungen; für jede grössere Arbeitsgattung wird ein (oder mehrere Pläne)
gezeichnet, was mit dem entsprechenden planerischen und in diesem Falle zeichneri-
schen Aufwand verbunden ist (z.B. Kanalisationsplan, Deckenplan, Aussparungsplan,
Detailplan etc.).
Abbildung 9: Beispiel eines Detailschnittes des Sockels als Grundlage für die Submission
39 Siehe auch: Konsistenz von Modellen in: Kapiel 3.4.2 Grenzen und Problempunkte - Computer Aided Architectural Drafting
40 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 320

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 25
——————————————————————————————————————————
Da oft noch nicht alles bis ins letzte Detail bekannt ist, wenn man zu bauen beginnt, ist
die Phase der Realisierung auch diejenige Zeit, während der manche Überraschungen zu
Tage treten, wie zum Beispiel der Zustand des Baugrundes, mögliche Altlasten, oder
aber dass gewisse Bauteile sich einander beim Einbau in die Quere kommen. Ein zwei-
dimensionaler Plan zeigt lediglich, wo ein Werkstück zu liegen kommt; wie es an diese
Stelle kommt, darüber wird in den meisten Planungen leider nicht gross nachgedacht.
Abgeholfen wird diesem Dilemma mit dem Einsatz von heute nutzbaren, digitalen
Werkzeugen, welche das einmal im Computer erstellte Gebäude analog einem räumli-
chen Puzzle zusammenstellen. Des Weiteren kann der Bauablauf mit solchen Hilfsmit-
teln optimiert, d. h. auf das nötige Minimum reduziert werden41. Nach der Erstellung
wird das Gebäude auf sämtliche Funktionen hin in der Phase 4.3 (Inbetriebsetzung) ge-
testet.
Abgeschlossen wird der Bauprozess dann mit der Phase 4.4 (Abschluss)42. Die nachge-
führten Werkpläne gehen als Bauwerksakten zu Dokumentationszwecken an den Eigen-
tümer über. Verlief alles zufriedenstellend, wird das Gebäude vom Eigentümer abge-
nommen. Nach einer Frist von zwei Jahren für das Rügen von sichtbaren Mängeln, fünf
Jahren für verdeckte Mängel und zehn Jahrem für absichtlich verschwiegene Mängel
endet meistens die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Auftraggeber.
3.1.5 Phase 5: Nutzung
Nebst dem eigentlichen Bauwerk übergibt der Architekt dem Besteller nach Erstellung
alle zur erfolgreichen Nutzung notwendigen Dokumente für die Phase der Bewirtschaf-
tung (Phase 5.1). Der Eigentümer strebt im Sinne des 'Best Owners'43 in der Regel eine
langfristige Nutzung an, die unter anderem auf einem optimierten Betriebsablauf, einem
tiefen Leerstand und tiefen Nebenkosten gründet. Sinnvoll gesetzte Instandhaltungs-
und Instandsetzungsintervalle garantieren einen langen Erhalt der Gebrauchstauglich-
keit und eine materielle Werterhaltung für den Eigentümer. Meist noch wichtiger als der
materielle Gebäudewert ist jedoch der Ertragswert bzw. die Cash-Flow-Rendite. Ob-
wohl bekannt ist, dass die Lebenszykluskosten schon nach 15 bis 20 Jahren so hoch sind
wie die Erstellungskosten44, gilt in den meisten Planungen immer noch die absolute
Höhe der Gebäudekosten als Mass aller Dinge. Als Grund hierfür kann das mangelnde
Know-How der Planer für die Belange der Bewirtschaftung, aber auch die oft wenig
41 Siehe auch: Kapitel 3.8 Building Information Modeling42 Vgl. Meyer-Meierling (1999), S. 343 ff.43 Vgl. CUREM (2004)44 Siehe auch: Interview mit Prof. Hansruedi Preisig zu den Themen Energieeffizienz, Gebäudevernetz-
ung und Lichtplangung: <http://www.futurebuilding.ch/futurebuilding/videos/index.php?video=5>; Abrufdatum: 16.06.2009, 17.00 Uhr.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 26
——————————————————————————————————————————
weitsichtige Einstellung der Investoren, insbesondere wenn das Objekt nach Erstellung
verkauft wird, gesehen werden. Die Weichen für eine erfolg- und ertragreiche Bewirt-
schaftung werden oft sehr früh in der Planung gestellt45 und sind teilweise irreversibel,
wie zum Beispiel die Anzahl und Lage von Erschliessungskernen.
Der Phase des Übergangs von der Erstellung zur Nutzung wird in vielen Fällen wenig
Beachtung geschenkt. Im besten Falle kriegt der Eigentümer oder der Erstnutzer eine
vereinfachte Variante der Werkpläne in Form von PDF-Dateien als Gebäudedokumenta-
tion. Und dies, obwohl während dieser Phase die mögliche Wertschöpfung für den pla-
nenden Architekten um einiges grösser wäre als während der Entwurfsphase46. Wurde
das ganze Gebäude aber von Beginn an als digitales 3D-Modell erstellt und bearbeitet,
so kann dies nun dank dem offenen Standard für Gebäudemodelle gemäss IFC47 direkt
und nahtlos in die Bewirtschaftung überführt werden.
3.2 Schnittstellenproblematik
Stellt man den nach SIA 112 definierten Bauablauf in einen grösseren Zusammenhang,
so wird ersichtlich, dass in den unterschiedlichen Phasen jeweils unterschiedliche Ak-
teure zusammenarbeiten. Der Übergang von einer Phase zur andern wie auch die Zu-
sammenarbeit zwischen verschiedenen Beteiligten ist ein latenter Herd von möglichen
Informationsverlusten. Folgende Abbildung zeigt in vereinfachter Weise, dass neben
dem Architekten eine Vielzahl von andern Akteuren, jeder zu seiner Zeit, am Projekt be-
teiligt ist.
Abbildung 10: Die phasenweise Zusammenarbeit der verschiedenen Akteuere bedingt viele verschiedene Schnittstellen.
45 Siehe auch: Abbildung 6, Seite 17: Verhältnis von Kosten zu deren Beeinflussbarkeit46 Siehe auch: Kapitel 4.3.2: Interview mit Prof. Dr. Ludger Hovestadt47 Vgl. Kiviniemi (2008)

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 27
——————————————————————————————————————————
Die Schwierigkeit der Projektkoordination besteht darin, die teils divergierenden Inter-
essen der beteiligten Planer so zu bündeln, dass ein für den Auftraggeber zufriedenstel-
lendes Resultat bezüglich Qualität, Kosten und Termine erzielt werden kann.
3.3 Kriterien der Hierarchisierung
Im Folgenden wird nun aufgezeigt, in welcher Form heute der Einsatz von rechnerge-
stützten Arbeitsmitteln möglich ist, wobei der Komplexitätsgrad der Methode als Krite-
rium der Hierarchisierung genommen wird. Blickt man zurück in die Geschichte, so ist
die Reihenfolge in etwa deckungsgleich mit der Entwicklung des Computereinsatzes in
der Architektur. Im Wesentlichen spannt sich das Feld auf zwischen den beiden Extre-
men 'Verschieben von Vektoren' (sog. Plänezeichnen, tiefe Komplexität) und der durch-
gehenden digitalen Simulation eines Gebäudes mittels 'Building Information Modeling'
(BIM, hohe Komplexität). Konkret handelt es sich um die ersten fünf der folgenden Be-
reiche:
- Computer Aided Architectural Drafting – Zweidimensionale Pläne
- Computer Aided Architectural Design – Dreidimensionale Modelle
- Computer Aided Architectural Design – Parametrisiertes Entwerfen
- Computer Aided Manufacturing (CAM) – Digitalisierte Produktion
- Building Information Modeling (BIM)
- Gebäudeautomation
- Internet-basierende Planungsplattformen
Der Vollständigkeit halber soll das Feld der Gebäudeautomation hier noch erwähnt und
im Folgenden kurz erklärt werden, obwohl es eher auf die Nutzung des Gebäudes ab-
zielt als zur Planung dazugerechnet werden kann.
Die Internet-basierende Planungsplattformen und Projekträume werden heute in vielen
Planungen eingesetzt. Ihr Einsatz zeigt auf, wie die Zusammenarbeit zwischen den Pla-
nern vonstatten geht. Sie werden hier ebenfalls kurz vorgestellt, obwohl damit eher eine
Aussage über die Zusammenarbeit zwischen den Planern gemacht werden kann, als
über den Grad der Digitalisierung des Architekturbüros.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 28
——————————————————————————————————————————
3.4 Computer Aided Architectural Drafting – Zweidimensionale Pläne
3.4.1 Grundlagen und Möglichkeiten
Einfache zweidimensionale CAAD-Programme (D für Drafting oder Zeichnen) funktio-
nieren als vektorbasierte Zeichenhilfen. Punkte, Linien, Linienzüge, Kreise und Splines
bilden dabei die Elemente, welche mit den Werkzeugen Positionieren, Ändern oder Lö-
schen bearbeitet werden können. Gearbeitet wird ähnlich wie am klassischen Zeichen-
brett. Die übereinander gelagerten Schichten an Zeichenpapier finden ihre Entsprechung
in der Verwendung von ein- und ausblendbaren Layern oder Ebenen, welche jeweils den
einzelnen Objekten zugewiesen sind. Vordefinierte Symbole vereinfachen die Arbeit mit
sich wiederholenden oder normierten, d.h. nicht abänderbaren Elementen. Gezeichnet
wird meist im Massstab 1:1, dargestellt und gedruckt aber in einem beliebigen Mass-
stab. Die zweidimensionale Zeichnung am Computer besticht zwar durch ihre Präzision,
denn selbst im städtebaulichen Massstab ist ein Gebäude bis auf etliche Stellen nach
dem Komma definiert. Dennoch verleitet diese Präzision bzw. Massstabslosigkeit des
Öfteren zu einer zu starken Fokussierung auf das Detail und das Ausblenden des Ge-
samtbildes. Sich wiederholende Gebäudeteile (Geschosse, gespiegelte Gebäudeflügel
bei Symmetrien etc.) lassen sich durch Kopieren ziemlich leicht erstellen. Moderne
Zeichnungsprogramme verwenden assoziative Zeichnungselemente. So passt sich bei-
spielsweise die Bemassung an geänderte Elemente automatisch an. Zudem stellen leis-
tungsfähige CAD-Systeme Programmierschnittstellen zur Erweiterung der Funktionali-
tät oder zur spezifischen Anpassung bereit, wie zum Beispiel das Entwerfen durch Para-
metrisierung.
3.4.2 Grenzen und Problempunkte
Trotz der Tatsache, dass zweidimensionale Architekturzeichnungen seit Hunderten von
Jahren im Einsatz sind, sind sie letztlich ein kodiertes Informationsmittel, welches vom
Leser erst entschlüsselt werden muss48. Das Verfassen und das Lesen von Plänen als ab-
strahiertes Abbild der geplanten Realität setzt ein bestimmtes Mass an Know-How vor-
aus, was dann jedoch nicht garantiert, dass die vom Planverfasser gedachte Information
tatsächlich beim Leser ankommt. Entsprechende Normen wie beispielsweise die Norm
SIA 400 (Planbearbeitung im Hochbau)49 stellen diesbezüglich ein Mindestmass an An-
forderungen für die Planherstellung sicher.
Vermutlich einer der grössten Nachteile des zweidimensionalen Zeichnens am Compu-
ter ist jedoch die fehlende Konsistenz der Daten. Die klassischen Planungsmittel des Ar-
48 Vgl. Kalay (2004) S. 120 ff.49 Siehe auch: <http://www.sia.ch/produktevoransicht/i400_2000_d.pdf>, Abrufdatum 27.06.2009, 22.10
Uhr.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 29
——————————————————————————————————————————
chitekten – Grundriss, Schnitt, Ansicht und Perspektiven – sind nicht automatisch lo-
gisch miteinander verbunden. Eine im Grundriss verschobene Türe muss zusätzlich in
der Ansicht um dasselbe Mass verschoben werden, damit alle Pläne wieder den gleichen
Projektinhalt widerspiegeln, d.h. konsistent sind. Die logische Verknüpfung der benutz-
ten Planungsmittel erfolgt über den Planer, was erfahrungsgemäss mit einem hohen
Mass an Unsicherheit und erhöhtem Kontrollaufwand verbunden ist.
Folgende Programme werden gemäss Umfragen und eigener Erfahrung heutzutage in
den Schweizer Architekturbüros für 2D-CAAD eingesetzt: Allplan® und VectorWorks®
von Nemetschek, ArchiCAD® von Graphisoft, AutoCAD® von Autodesk, MicroStation®
von Bentley Systems. Neben den jeweils programmspezifischen und daher meist pro-
prietären Datenformaten haben sich die vom Autocad® stammenden Dateiformate DWG
und DXF für den Datenaustausch von zweidimensionalen Zeichnungen durchgesetzt.
3.4.3 Anwendungsbeispiele
Abbildung 11: Beispiel einer zweidimensionalen, vektorbasierten Zeichnung

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 30
——————————————————————————————————————————
3.5 Computer Aided Architectural Design – Dreidimensionale Modelle
3.5.1 Grundlagen und Möglichkeiten
Schon die ersten in den 60er Jahren entwickelten CAD-Systeme arbeiteten mit der drit-
ten Dimension. Das Ziel eines solchen Systems ist die Darstellung der Geometriedaten
eines oder mehrere Objekte entlang der drei Konstruktionsachsen im Raum. Dabei kön-
nen mehrere Modellierungsarten unterschieden werden:
Beim Drahtmodell werden die Volumina und Flächen mittels der gedachten Verbindung
zwischen den Fixpunkten gebildet, analog dem Gestänge eines Zeltes. Die Leserlichkeit
ist jedoch eingeschränkt, da auch nicht sichtbare Kanten abgebildet werden. Beim Flä-
chenmodell beschreiben mathematische Formeln die Flächen, welche die Volumen defi-
nieren. Diese Flächen können zweidimensional sein oder aber auch aus komplexeren
Formeln wie NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) zusammengesetzt sein, analog
dem Stoff, der das Gestänge des Zeltes überspannt. Beim Volumenmodell wird zusätz-
lich zu den relevanten Flächen festgehalten, wo Masse ist und wo nicht, die Flächen
werden zu Begrenzungsflächen von Volumen. Mittels boole'schen Operationen können
so Volumen miteinander addiert, voneinander subtrahiert oder Schnittmengen erstellt
werden. Das Körpermodell beinhaltet alle genannten Modelle plus zusätzliche nicht-
geometrische Informationen wie Material oder Oberflächenbearbeitung. Eine weitere
Möglichkeit, ein dreidimensionales Objekt abzuspeichern, ist die Konstruktionshistorie.
Alle Bearbeitungs- und Veränderungsschritte einer Grundgeometrie werden hierbei ge-
sichert, was eine hohe Flexibilität für spätere Veränderungen zur Folge hat.
Ein grosser Vorteil von 3D-Modellen zu 2D-Zeichnungen ist die Konsistenz des Mo-
dells. Die verschiedenen Geometrieelemente, besonders das 3D-Modell und die davon
abgeleitete Zeichnung sind assoziativ miteinander verknüpft. Beispielsweise ändert sich
die 2D-Zeichnung automatisch entsprechend, wenn man das dreidimensionale Modell
ändert. Die Zeichnung wird hierbei vom Modell abgeleitet, nicht umgekehrt. Die Kon-
sistenz muss nicht wie bei zweidimensionalen Grundrissen und Schnitten durch den
Zeichner oder Architekten sichergestellt werden, sie ist im Modell immanent.
Neben den in Kapitel 3.4.2 schon erwähnten CAD-Programmen, welche alle auch 3D-
Funktionalitäten aufweisen, sind unter anderem folgende Programme für die Bearbei-
tung von 3D-Modellen bei uns verbreitet: FormZ® von AutoDesSys, Revit® und 3ds
Max® von Autodesk, Rhinoceros 3D® von McNeel oder Cinema4D® von Maxon.
Digitale, dreidimensionale Gebäudemodelle werden heutzutage in den Architekturbüros
hauptsächlich dazu verwendet, das Projekt im digitalen Raum zu überprüfen und darzu-
stellen. Hierbei kann das mit Vektoren beschriebene dreidimensionale Gebäudemodell
mit weiteren Attributen angereichert werden, z.B. mit Materialoberflächen, Texturbilder,

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 31
——————————————————————————————————————————
Lichtquellen oder Blickpunkten. In einem sehr rechenintensiven Prozess rechnet der
Computer das Vektormodell in ein gerastertes, zweidimensionales Bild um. Beim einfa-
chen 'Texture Mapping' wird sozusagen ein Bild eines Materials über das Drahtmodell
gezogen. Heutige Renderingprogramme sind mittlerweile sehr ausgeklügelt und simu-
lieren komplexe optische Prozesse wie Lichtbrechungen, Refraktionen oder verschiede-
ne Arten von Transparenzen. Je präziser die physikalischen Eigenschaften der Material-
oberflächen derjenigen echter Materialien entsprechen, desto näher rückt das Gesamt-
bild an eine Realität. Die dafür benötigten Programme sind einerseits als eigenständige
Renderer erhältlich oder aber als erweiterbares Modul bei etlichen 3D-Modellier-Pro-
grammen.
3.5.2 Grenzen und Problempunkte
Dreidimensionale Gebäudemodelle bilden die (geplante) Wirklichkeit schon sehr gut ab.
Jedoch beschränken sich die meisten Anwendungen und Anwender auf die geometri-
schen Informationen. Den Aufwand, ein geplantes Projekt zuerst komplett digital zu er-
stellen, nehmen erfahrungsgemäss nicht viele Büros auf sich. Bei den meisten Anwen-
dern ist spätestens nach etwaigen Visualisierungen Schluss mit der dritten Dimension.
Für die weitere Planung (Baueingabe, Ausführungsplanung) werden konventionelle
zweidimensionale Planzeichnungen eingesetzt. Sind Visualisierungen das einzige Ziel
eines dreidimensionalen Modells, werden meist nicht alle Gebäudeteile modelliert, son-
dern nur diejenigen, welche für das Bild relevant, d.h. sichtbar sind. Ebenso wird die
Dimension Zeit bei einem 3D-Modell ausser acht gelassen; es interessiert nur der End-
zustand, nicht in welcher Reihenfolge die Bauteile eingesetzt werden.
Alles in allem waren oder sind dreidimensionale Gebäudemodelle für Architekten eine
verheissungsvolle Alternative zu den bekannten, konventionellen Arbeitsinstrumenten.
Spätestens jedoch in der Phase der Realisierung werden wieder bekannte und bewährte
Methoden und Arbeitsmittel wie der Werkplan angewendet.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 32
——————————————————————————————————————————
3.5.3 Anwendungsbeispiele
Abbildung 12: Beispiel einer Visualisierung: 1: Drahtmodell, 2: Flächenmodell, 3: Volumenmodell, 4: Körpermodell (Rendering) als Nacht-Lichtstudie, 5: Tag-Lichtstudie, 6: Fertiges Bild
3.6 Computer Aided Architectural Design – Parametrisiertes Entwerfen
3.6.1 Grundlagen und Möglichkeiten
Grundsätzlich können zwei fundamental unterschiedliche Arten unterschieden werden,
Objekte eines digitalen Modells zu beschreiben: parametrisch und nicht-parametrisch50.
Viele CAD-Systeme der früheren Generationen benutzten nicht-parametrische, meist
rein geometrische Methoden an, welche die Darstellung der Objekte zum Ziel hatten.
Die Objekte als Bestandteile eines Modells wurden als zwei- oder dreidimensionale
geometrische Beschreibung der tatsächlich geplanten Form geschrieben. Betrachtet man
jedoch die angestrebte Form nicht als alleinigen Selbstzweck, sondern als Resultat von
50 Vgl. Schodek et al. (2005) s. 186 ff.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 33
——————————————————————————————————————————
dahinter liegenden Parametern, so begibt man sich auf eine höhere Abstraktionsstufe.
Die Darstellung eines Wohnungsgrundrisses in der folgenden Abbildung (Abbildung 13)
ist eine mögliche Abstraktion der tatsächlich physisch vorhandenen Wohnung.
Abbildung 13: Wohnungsgrundriss einer 4½-Zimmer-Wohnung und zwei Möglichkeiten der Abstraktion
Abstrahiert man den Grundriss noch mehr, wie in der Darstellung rechts ersichtlich, so
kann der daraus resultierende Grundriss als ein mögliches Resultat des rechten Schemas
verstanden werden. Geht man noch weiter und ordnet die einzelnen Räume in Tabellen-
form, bzw. die Beziehungen untereinander in einer Matrix an, wie in der unteren Dar-
stellung ersichtlich, so entfernt man sich noch mehr von der ursprünglichen Geometrie
hin zur 'reinen' Information.
Dieser Weg der Abstraktion kann nun im Entwurf auch umgekehrt gegangen werden. In
einer ersten Phase werden alle gewünschten Räume und ihre Beziehung zu andern Räu-
men aufgelistet. Weitere mögliche Anforderungen wären beispielsweise: 'hat ein Fenster
oder nicht', 'ist auf die Hofseite oder die Strassenseite hin ausgerichtet', etc. Der Compu-
ter wird nun eingesetzt, alle Möglichkeiten durchzurechnen und darzustellen, welche al-
len Anforderungen genügen. Die Menge der Möglichkeiten wird umso kleiner, je mehr
Anforderungen man in Form von Parametern einsetzt. Veränderungen erfolgen dann

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 34
——————————————————————————————————————————
nicht an der resultierenden Form, sondern an den der Form zu Grunde liegenden Stell-
schrauben, den einzelnen Parametern.
Der Einsatz von parametrisierten Prozessen oder Entwurfsautomaten beschränkt sich je-
doch nicht auf Grundrisse. Selbst in der Planung von ganzen Quartieren kann so auf die
Wünsche von einzelnen Grundbesitzern Rücksicht genommen werden, ohne die überge-
ordnete Planung ganz in Frage zu stellen. Dank der Leistungsfähigkeit heutiger Rechner
ist das Resultat solcher Einflüsse in Echtzeit direkt ersichtlich51. Dank dem Einsatz para-
metrisierter Entwürfe verlagert sich das Interesse weg von der reinen Geometrie, hin zu
denjenigen Faktoren, welche die Form generieren. Einer der Hauptvorteile des compu-
tergestützten Entwurfes ist die Fähigkeit, aus einer beinahe endlosen Menge von mögli-
chen Lösungen die 'optimalste' Lösung herauszufinden (statistisches Design). Ebenfalls
einfacher zu handhaben werden hiermit nicht-orthogonale Gebäudeentwürfe wie das
Guggenheim Museum von Frank Gehry in Bilbao.
Beinahe sämtliche heute eingesetzten CAD-Systeme52 verfügen über Schnittstellen, um
parametrisierte Entwürfe einzusetzen. Die Bedienung erfolgt jedoch noch über selbst
programmierte Skripts. Es ist absehbar, dass die Software-Entwicklung diesem Mangel
Rechnung tragen wird, und einfach zu bedienende Entwurfsautomaten integrierte Be-
standteile in den nächsten CAD-Versionen sein werden.
3.6.2 Grenzen und Problempunkte
Entwurfsautomaten haben ein grosses Feld von möglichen Einsatzgebieten geöffnet.
Vom Möbel über den Grundriss bis zum Städtebau ist es denkbar, dem Rechner Kom-
petenzen zu übertragen, welche sonst dem Architekten vorbehalten waren. Hier liegt je-
doch auch die Grenze des Einsatzes. Um etwas dem Computer zu übertragen, muss es
parametrierbar, d.h. in Zahlen abbildbar sein. Bei Raumgrössen oder Beziehungen zwi-
schen Räumen ist dies noch gut vorstellbar. Schwieriger aber immer noch umsetzbar
wird es bei Begriffen wie 'schöne Raumproportionen' oder 'äussere Erscheinung'. Es ist
immer noch der Mensch, welcher schlussendlich mit dem Einstellen der Parameter die
Auswahl trifft, aus einer sehr grossen Grundgesamtheit die 'optimalste' Lösung zu fin-
den. Der Computer bleibt ein Werkzeug, das maximal so gut ist, wie die Person, die es
bedient.
51 Siehe auch Kapitel 3.6.352 Siehe auch Kapitel 3.4.2

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 35
——————————————————————————————————————————
Ein weiterer Faktor, welcher den Einsatz von Entwurfsautomaten beschränkt, ist die
Tatsache, dass die Wertschöpfung in der Phase des Entwurfes nicht sonderlich gross
ist53. Zwar werden hier die für den Lebenszyklus eines Gebäudes wichtigsten Weichen
gestellt; nur dauert die Phase des eigentlichen Entwurfes gemessen am gesamten Pla-
nungsprozess nicht sehr lange. Zudem sieht eine Vielzahl von Architekten genau in die-
ser kurzen Phase eine ihrer Kernkompetenzen. Mit andern Worten, mit dem Einsatz von
Entwurfsautomaten versucht man, die meist schlecht honorierte Phase des architek-
tonischen Entwurfes vom Architekten auf den Computer zu übertragen. Da auch der au-
tomatisierte Entwurf betreut werden muss, wird sich die Wertschöpfung hier auch in Zu-
kunft nicht merklich erhöhen.
Herbert Moelle weist in seiner Dissertation54 nach, dass unter anderem die komplizierte
Kommunikation mit dem Computer (Human User Interface HUI) schuld daran ist, dass
der Rechner (noch) nicht in grösserem Masse in der Entwurfsphase eingesetzt wird. Ein
'(...) intuitiv benutzbares Entwurfsmodul (welches) die Semantik im Entwurfprozess
(...)'55 ergänzen würde, wäre nötig, um sicherzustellen dass die Kreativität durch den
Computereinsatz nicht unterbrochen wird.
3.6.3 Anwendungsbeispiele
Abbildung 14: Beispiel einer computergenerierten und von einem Industrieroboter gemauerten Ziegel-steinwand (Schweizer Beitrag an der Architektur-Biennale in Venedig, 2008)
53 Siehe auch Kapitel 4.3.2 Interview mit Prof. Dr. Ludger Hovestadt54 Vgl. Moelle (2006)55 Vgl. Moelle (2006), S. 1

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 36
——————————————————————————————————————————
Links zu weiteren Beispielen:
Beispiel eines sich interaktiv anpassenden Quartierplanes:
<http://www.kaisersrot.com/Kaisersrot/Welcome.html>
Beispiel eines vollständig am Computer generierten und mit einer computergesteuerten
Fräse hergestellten würfelförmigen Pavillons:
<http://wiki.caad.arch.ethz.ch/Events/XCubeSnow>
Beispiel einer computergenerierten Rasenlandschaft:
<http://netzspannung.org/database/348472/de>
3.7 Computer Aided Manufacturing (CAM) – Digitalisierte Produktion
3.7.1 Grundlagen und Möglichkeiten
Der 'Crystal Palace' (1851) von Joseph Paxton wie auch der Eiffelturm (1887) von Gu-
stave Eiffel zeigten als erste grössere Stahlkonstruktionen, was mit dieser damals neuen
Technologie möglich war. Rund hundert Jahre später hat sich der Stahlbau durchgesetzt,
praktisch jede moderne Grossstadt verfügt in ihrer Silhouette über eine Anzahl aus
Stahlkonstruktionen hochgezogener Hochhäuser56. Eine ähnliche Rolle übernimmt in
unserer Zeit das 'Guggenheim Museum' in Bilbao vom Architekten Frank O. Gehry. Als
eines der ersten im grösseren Stil hergestellten Gebäude wurden die Bauteile vorwie-
gend mit digitalen Hilfsmitteln hergestellt. Oder, mit den Worten von John K. Waters:
'Frank O. Gehry shows a generation how to design beyond the box'57.
Ein wichtiges Merkmal von digital hergestellten Bauten oder Bauteilen liegt sicherlich
im höheren Freiheitsgrad bezüglich der Form. Beispielsweise erlaubt eine normale
Bandsäge lediglich Kurven in einer Dimension in ein Brett zu sägen, während eine
CNC-gesteuerte Fräsmaschine dreidimensionale Kurvenlandschaften aus einem massi-
ven Stück Holz zu subtrahieren vermag (siehe Abbildung 15).
Die digitalen Daten sind eine Voraussetzung für die digitale Produktion. Es ist nicht nö-
tig, sie auf klassischem Wege in Form von Zeichnungen und Plänen auszudrucken. Die
Daten werden aufbereitet und direkt auf Maschinen geleitet. Im CAM werden die Roh-
daten für die Fertigung von Einzelteilen und die Montage von Baugruppen gesammelt
und diese in verschiedene Arbeitsschritte strukturiert.
56 Vgl. Kolarevic (2003)57 Vgl. Waters (2003), S. 30

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 37
——————————————————————————————————————————
Ein Hauptanliegen von CAM ist der schnellere Produktionsprozess bei höherer Präzisi-
on, ebenfalls von Bedeutung ist die bessere Ausnützung der Rohstoffe. Digital gesteuer-
te Maschinen gehören in Bereichen wie dem Automobil- oder Flugzeugbau schon seit
Längerem zum Alltag. Auch industriell hergestellte Massenprodukte und Alltagsgegen-
stände wie Computer, Telefone etc. basieren auf ähnlichen Technologien. Lediglich die
Baubranche ist noch gekennzeichnet von handwerklichen Tätigkeiten vor Ort.
Ohne auf alle möglichen mechanischen Prozesse im Einzelnen einzugehen, lassen sich
die Verfahren in die drei Bereiche Subtraktion, Guss und Addition einteilen58. Unter
Subtraktion werden alle Verfahren verstanden, bei welchen von einem vorgegebenen
Volumen aus einem bestimmten Material durch Wegnehmen das gewünschte Werkstück
entsteht. Dazu zählen einfache mechanische Prozesse wie Sägen, Bohren, Drehen, Ho-
beln oder Schleifen. Weit verbreitet ist der Prozess des Fräsens mittels CNC-Fräsen.
Hierbei trägt ein rotierender und beweglicher Fräskopf schichtweise Material vom
Werkstück ab. Je nach Bewegungs- und Freiheitsgrad des Fräskopfes (Achsen) können
unterschiedlich komplexe Formen gefräst werden. Folgende Abbildung zeigt eine CNC-
Fräse mit drei Achsen:
Abbildung 15: CNC-gesteuertes Fräsen als ein subtraktives Verfahren; Quelle: Gramazio, Fabio / Kohler, Matthias (2008): Digital Materiality in Architecture; Baden, 2008; S. 60 und S. 15
Das subtraktive Verfahren lässt sich auch für die Herstellung von Gussformen einsetzen.
CNC-gesteuerte Fräsmaschinen höhlen grosse Styrofoamblöcke derart aus, dass sie als
Gussformen für Betonelemente benutzt werden können. Der Form sind hier (fast) keine
Grenzen gesetzt.
58 Vgl. Schodek (2005), S. 255 ff.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 38
——————————————————————————————————————————
Zu den additiven Verfahren zählt das Sintern (siehe Abbildung 16). Ein Becken wird zu-
erst mit einem feinen Pulver gefüllt. Ein Laser visiert nun diejenigen Punkte an, welche
zum Volumen des herzustellenden Werkstückes zählen. Die angelaserten Punkte erhär-
ten (sintern) und das fertige Werkstück ergibt sich aus der Summe aller erhärteten Punk-
te. An Stelle des üblichen Keramik- oder Metallpulvers werden auch flüssige Polymere
zum Sintern verwendet. Da die Grösse der Bauteile, bedingt durch die Herstellungsart,
beschränkt ist, werden in der Architektur (bis jetzt) lediglich Modelle mit dieser Metho-
de hergestellt.
Abbildung 16: Prinzipskizze des Sinterns mit Laser (links) und des 3D-Druckers
Fragt man sich nach den hauptsächlichen Beweggründen für den Einsatz digitaler Pro-
duktionsmittel, so sind sicherlich folgende zwei Argumente zu nennen. Kann einerseits
das Produzieren von Werk- oder Bauteilen einer Maschine übertragen werden, so arbei-
tet diese oft präziser als der Mensch. Wird das Bauteil in grosser Stückzahl hergestellt,
so sinken auch die Grenzkosten und das Bauteil wird insgesamt billiger. Eine weitere
Motivation ist das Bauen von Formen, die mit konventionellen Technologien nicht oder
nur sehr schwer möglich sind.
3.7.2 Grenzen und Problempunkte
Bei aller Faszination der Möglichkeiten, die einem die digitale Produktion bietet gibt es
jedoch auch Limiten. Digital hergestellte Bauteile werden praktisch immer in einer
Werkstatt vorfabriziert. Das heisst, ihr Gewicht und ihr Volumen ist limitiert durch die
Transportmöglichkeiten von der Werkstatt zur Baustelle. Dies ist mit ein Hauptgrund,
weshalb diese Technologie beispielsweise für die Produktion von Fenstern sehr gut ein-
setzbar ist. Ein vollflächige Betondecke in Ortbeton kann jedoch unmöglich vorfabri-
ziert und transportiert werden. Eine weitergehende Digitalisierung bedingt auch hier
neue Denkweisen und neue Prozesse.

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 39
——————————————————————————————————————————
3.7.3 Anwendungsbeispiele
Abbildung 17: Computergenerierte und mittels CNC-Fräsen hergestellte Betonschalung (Projekt: Neuer Zollhof, Düsseldorf, Architekt Frank O. Gehry): Eine CNC-gesteuerte Fräse (A) schneidet aus einem Sty-rofoamblock die am Computer generierte Schalung aus (B) für die vorfabrizierten Betonelemente (C).
Links zu weiteren Beispielen:
(Siehe auch Kapitel 3.6.3: Anwendungsbeispiele zum parametrisierten Entwerfen)
Beispiel von computergenerierten digital hergestellten Akustikpanelen aus Bauschaum:
<http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/d/lehre/144.html>
Beispiel einer computergenerierten mittels CNC-Fräsen hergestellten Betonschalung:
Rolex Learning Center, EPFL Lausanne, Sanaa Architekten, Japan.
<http://learningcenter.epfl.ch/>
3.8 Building Information Modeling (BIM)
3.8.1 Grundlagen und Möglichkeiten
Der Begriff 'BIM' wird heute im CAD-Bereich für sehr vieles benutzt. Es hat sich noch
keine allgemeingültige Definition durchgesetzt. Gemäss Mortenson ist BIM eine „in-
telligente Simulation von Architektur“59. Dabei müssen folgende sechs Bedingungen der
Simulation erfüllt sein:
1. Die Daten sind digital vorhanden.
2. Das Modell beschreibt Räume (dreidimensional).
3. Die Quantitäten sind messbar und haben eine Dimension.
4. Die Daten beschreiben das Modell umfassend, konsistent und nicht-redundant.
59 Vgl. Eastman et al. (2008), S. 13

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 40
——————————————————————————————————————————
5. Die Daten sind zugänglich für das ganze Planungsteam.
6. Die Daten sind dauerhaft nutzbar (während des ganzen Lebenszyklus').
Dass die Daten eines BIM-Modells digital vorhanden sein müssen, versteht sich von
selbst. Ebenso, dass damit Räume beschrieben werden. Geometrische, dreidimensionale
Gebäudemodelle decken nur die ersten drei Bedingungen ab, sie beinhalten keine Ob-
jektattribute, lediglich geometrische Informationen. Den Objekten fehlt es an Intelli-
genz. Die vierte Bedingung beinhaltet Daten wie Materialien, Oberflächenbeschaffen-
heit, Kosten, Einbauzeitpunkt im Bauprozess etc., kurz, alles, was man über das spezifi-
sche Objekt oder Bauteil weiss. Die Zugänglichkeit der Daten für das ganze Planungs-
team ist eine Grundvoraussetzung, dass gemeinsam am gleichen Gebäudemodell gear-
beitet werden kann. Einerseits kann dies bewerkstelligt werden, indem alle Planer mit
Software aus dem gleichen Hause arbeiten. Andererseits kann auch sog. offene Software
bzw. nicht-proprietäre Datenformate gemäss den IFC-Standards benutzt werden. Auch
macht es Sinn, dass die Daten während des ganzen Lebenszyklus' eines Gebäudes nutz-
bar sind.
Da die Planung und der Bau von Gebäuden viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen
und letztlich auch viel Geld kostet, sollten die Ressourcen zielorientiert eingesetzt wer-
den. Ein durchgehend digitalisiertes, nach BIM-Massstäben geplantes Gebäude si-
muliert das gesamte Gebäude wie auch den Bau. Da die Objekte mit Preisen verknüpft
sind, lassen sich sehr präzise Kostenprognosen ableiten. Allfällige Änderungen haben
eine direkt sichtbare Auswirkung auf den Preis. Der Besteller sieht so schon früh in der
Planung, ob der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Weiter können alternative Ent-
würfe einfacher generiert werden, als wenn man bei jeder Variante wieder bei Null be-
ginnen muss. Das Gebäude kann zudem in jeder Phase visualisiert werden, es setzt sich
nicht lediglich aus verschiedenen zweidimensionalen Ansichten zusammen, da es jeder-
zeit konsistent ist. Entscheidet man sich zu einem gegebenen Zeitpunkt für eine Varian-
te, können zweidimensionale Pläne, ausgehend vom dreidimensionalen Gebäudemodell,
abgeleitet werden. Erhöhte Anforderungen stellt das interdisziplinäre Arbeiten an die
Koordination der Planer. Allerdings ist es schwieriger und um einiges zeitaufwändiger,
wenn die Zusammenarbeit mit zweidimensionalen Plänen bewerkstelligt wird. Gebäu-
detechnische Untersuchungen wie Gesamtenergieverbrauch, Aerodynamik bei Hoch-
häusern, Schattenwurf oder Minergie-Anforderungen gehen viel einfacher vonstatten als
über den zweidimensionalen Weg.
Mit der Benutzung von 4D-Design (mit dem Faktor Zeit als 4. Dimension) eröffnen sich
weitere neue Wege. Der gesamte Bauprozess kann simuliert und auf bestimmte Kriteri-
en hin optimiert werden. Dies sind beispielsweise eine limitierte Bauzeit, eingeschränk-
te Zufahrtswege oder Witterungsabhängigkeit. Das in sich konsistente Gebäudemodell

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 41
——————————————————————————————————————————
zeigt beim simulierten Zusammenbau auch systematische Fehlerquellen auf. Beispiels-
weise passt eine Küchenzeile auf dem 2D-Plan und im 3D-Modell exakt in die dafür
vorgesehene Stelle. Wie das Bauteil jedoch in die Küche gelangt und ob die Fensteröff-
nungen zu diesem Zeitpunkte noch genügend gross sind, sieht man erst in der Simulati-
on des Bauablaufes. Ein dreidimensionales Gebäudemodell ist, da schon digital defi-
niert, prädestiniert für den Einsatz von digitalen Produktionsmitteln wie beispielsweise
CNC-Fräsen. Solche Automationen sind heute Standard in Bereichen wie Stahlbau, vor-
fabrizierte Betonelemente oder Fensterbau. Diese 'Off-Site-Konstruktion' reduziert die
Bauzeit und somit auch die Baukosten massgeblich. Da nach BIM-Massstäben geplante
Gebäude viel weiter reichende und akkurate Daten beinhalten, ist es möglich, Techniken
wie 'Lean Construction'60 zu verwenden. Die Materialien und auch die Bauarbeiter kön-
nen so zeitgenau und zielgerichtet eingesetzt werden.
Auf eine erfolgreiche und intelligente Simulation eines Gebäudes mit BIM erfolgt dann
auf der Baustelle lediglich noch das Zusammenfügen jener Teile, die schon am Compu-
ter zusammenpassen.
Nach der Erstellung des Gebäudes werden normalerweise die Papierpläne dem Bau-
herrn als Revisions- und Dokumentationspläne übergeben. Da jedoch moderne Facility-
Management-Systeme ebenfalls mit Gebäudemodellen arbeiten, ist es sinnvoll, die für
die Planung und den Bau benötigten Modelle zur Nutzung weiterhin einzusetzen. Ge-
bäudemodelle nach IFC-Standards sind hier die ideale Plattform für den phasenüber-
greifenden Einsatz. Obwohl viele Softwarehersteller mit dem Namen 'BIM' werben, er-
lauben die wenigsten eine vollständige, durchgehende Digitalisierung. Neben Archi-
CAD® von Graphisoft ist hier insbesondere Revit® von Autodesk zu erwähnen; beide
Programme erlauben eine intelligente, digitale Simulation von Projekten.
Folgende Abbildung zeigt einen qualitativen Vergleich zwischen dem Bereich BIM, pa-
rametrischem Entwerfen, objektorientiertem CAD und konventionellem CAD bezüglich
Aufwand (effort) und Auswirkung (effect). Daraus ist ebenfalls ersichtlich, dass BIM
nicht lediglich ein weiteres Werkzeug ist wie ein CAD-Programm, mit welchem man
Pläne zeichnen kann. Vielmehr steckt eine grundlegend andere Herangehensweise an
die Bauplanung gegenüber konventionellen Methoden dahinter.
60 Siehe auch Kapitel 2.2: Rationalisierung aus wirtschaftstheoretischer Sicht

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 42
——————————————————————————————————————————
Abbildung 18: Vergleich zwischen BIM, parametrischem Entwerfen, objektorientiertem CAD und kon-ventionellem CAD
3.8.2 Grenzen und Problempunkte
Bei allen genannten Vorteilen muss dennoch festgehalten werden, dass ein intelligenter
Einsatz von BIM die Denk- und Arbeitsweise wie auch die Arbeitsprozesse der betei-
ligten Planer nachhaltig beeinflusst. Gefragt ist eine möglichst frühe Zusammenarbeit
aller Planer am gemeinsamen Gebäudemodell. Ein weiterer noch ungeklärter Punkt ist
die Frage nach dem Urheberrecht und demzufolge die Frage nach der Haftung. In einer
konventionellen Planung ist klar ersichtlich, wer wann welche Inputs brachte. Jeder Pla-
ner haftet für seinen bearbeiteten Teil am Gebäude, für den er nota bene auch sein Ho-
norar erhält. In einem interaktiven und interdisziplinären Planungsprozess ist dies nicht
so einfach möglich. Es wird sich weisen, wie mit diesen Punkten in Zukunft umgegan-
gen wird. Noch wichtiger als in konventioneller Planung wird bei interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit das Management von Information und Wissen (Knowledge Manage-
ment).
Alles in allem stellt die Projektbearbeitung mit 'Building Information Modeling' BIM
ein zukunftsweisendes, neues Betätigungsfeld aller Planer dar. Jedoch reicht es nicht
aus, dasselbe auf eine andere Art zu machen 'not just doing the same things in a new
way'61, es bedingt ein radikales Umdenken der Prozesse sämtlicher Beteiligter.
61 Vgl. Eastman et al. (2008), S. 22

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 43
——————————————————————————————————————————
3.8.3 Anwendungsbeispiele
Abbildung 19: Das nach BIM-Massstäben erstellte Gebäudemodell lässt sich für die verschiedensten Simulationen und Analysen einsetzen.
3.9 Gebäudeautomation
3.9.1 Grundlagen und Möglichkeiten
Ein weiteres Anwendungsfeld für Computer ist die Gebäudeautomation. Obwohl diese
eher während der Nutzungsphase und des Betriebs des Gebäudes eine Rolle spielt, soll
sie hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden.
Auf Feedback-Schlaufen basierende, selbstregulierende Systeme sind seit langem be-
kannt. Beispielsweise lässt das Thermostat-Ventil einer Heizung solange heisses Wasser
durch die Leitungen durch, bis eine bestimmte Grenztemperatur erreich ist. Die Tempe-
ratur beginnt zu fallen, bis der untere Grenzwert erreicht ist und das Ventil erneut geöff-

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 44
——————————————————————————————————————————
net wird. Weitere Beispiele von Systemen, die auf einen äusseren Reiz hin reagieren
sind automatisch öffnende Türen, Lichter, die mit Bewegungsmeldern verbunden sind
oder ein Sonnenschutz, der bei starker Sonneneinstrahlung automatisch runterfährt.
In einem nächsten Schritt gilt es nun, diese einzelnen Regelkreise zu vernetzen und so
dem System 'Intelligenz' einzuhauchen bzw. das System lernfähig zu machen. So steu-
ern beispielsweise moderne Gebäudeleitsysteme Lifte dorthin, wo die meisten Leute zu
erwarten sind. Am Morgen warten die Lifte tendenziell in den unteren Geschossen, denn
die Erfahrung zeigt, dass die meisten Leute von diesen Geschossen her die Lifte betre-
ten. Während der Mittagszeit und am Abend sind dies eher die oberen Geschosse.
Es lassen sich nun alle erdenklichen Einzelsysteme zu einem 'intelligenten' Gesamtsys-
tem zusammenschliessen, welches das menschliche Verhalten registriert und darauf rea-
gieren kann, d.h. lernfähig ist. Des Weiteren zielt die heutige Forschungstätigkeit auf die
'intelligente' Anpassung an die Umwelteinflüsse eines Gebäudes62. Hierbei geht es dar-
um, einzelne Gebäudeteile mit Information und falls nötig mit Energie zu versorgen, mit
dem Ziel, möglichst ressourcenschonend bestimmte Funktionen auszuführen, z.B. die
Belüftung oder die Belichtung der Räume. Moderne Gebäudeleitsysteme verstehen sich
dabei eher als Netzwerk selbstregulierender Teile, denn als zentral gesteuerte Einheit.
3.9.2 Grenzen und Problempunkte
Ähnlich wie der bei Bauplanung mit BIM bedingt die Gebäudeautomation ein Umden-
ken in der Planung und Nutzung von Gebäuden. Das Bild eines (lebenden) Organismus'
kommt der Idee eines modernen Gebäudes schon näher als das einer perfekt abgestimm-
ten und nur auf sich bezogenen Maschine, welche die klassische Moderne beabsichtigte.
3.9.3 Anwendungsbeispiele
Beispiel eines emissionsfreien und energieautarken Hauses mit einer intelligenten Ge-
bäudeautomation: Haus von Prof. Dr. Werner Sobek, Stuttgart:
<http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/290/12/Anhang_B11_B13.pdf>
62 Vgl. Eastman et al. (2008), S. 451: Total Environmental Adaptability

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 45
——————————————————————————————————————————
3.10 Internet-basierende Planungsplattformen
Da die Planung von Bauten je länger je mehr von intensiver Zusammenarbeit geprägt
ist, werden vor allem bei grösseren Projekten die Daten nicht mehr in einem Planungs-
büro abgelegt, sondern auf speziell dazu vorgesehenen Planungsplattformen. Diese
funktionieren als Drehscheibe für Informationen aller am Projekt beteiligten Planer.
Ausschreibungsunterlagen, Offerten, Pläne etc. werden mit den jeweiligen Zugriffsrech-
ten versehen und verwaltet. Die wohl bekannteste in der Schweiz ist die Plattform von
Olmero63. Eine weitere Plattform, die CRB-Box von der CRB64 hat zum Ziel, die ver-
schiedenen Kostengliederungsarten im Bauprozess (Normpositionskatalog NPK, Bau-
kostenplan BKP und Elementkostengliederung EKG) zu standardisieren und in eine in-
ternet-taugliche Sprache zu übersetzen.
3.11 Vergleich der Planungsphasen mit den Computereinsatzmöglichkeiten
Vergleicht man die in Kapitel 3.1 geschilderten Phasen einer Planung mit den in den
Kapiteln 3.4 bis 3.9 erwähnten Einsatzgebieten von Computern (Abbildung 20), so ist
unter anderem ersichtlich, dass sich der konventionelle Einsatz von zweidimensionalen
Plänen und Zeichnungen über die gesamte Planungsphase erstreckt, jedoch selten über
diese hinausgeht. Geometrische 3D-Modellierungen und Parametrisierung machen vor
allem in der Entwurfsphase Sinn, ebenso der digitale Modellbau. Mit 4D-Design lässt
sich der Ablauf des Baus planen und optimieren, was eher zur Realisierungsphase ge-
hört. Die digitale Produktion zielt, wie der Name schon sagt, auf das Herstellen von
Bauteilen ab. Die genannten Planungswerkzeuge sind einerseits stark auf eine spezielle
Planungs- oder Bauphase bezogen, anderseits sind sie auch mehr oder weniger stark ge-
kennzeichnet durch Prozessbrüche. Dem gegenüber steht eine durchgehende Digitalisie-
rung der Planung mittels BIM, wie erwähnt, einer „intelligenten Simulation von Archi-
tektur“.
63 Siehe: http://www.olmero.ch64 Siehe: http://www.crbox.ch

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 46
——————————————————————————————————————————
Abbildung 20: Vergleich der Planungsphasen mit den Computereinsatzmöglichkeiten

Computereinsätze in der aktuellen Bauplanung 47
——————————————————————————————————————————
3.12 Grad der Digitalisierung
Der Titel dieser Arbeit 'Der Digitalisierungsgrad der Schweizer Architekturbüros' bein-
haltet den Begriff Grad, lateinisch 'gradus', für Schritt, Stufe, Absatz oder Rang. Da das
Ermitteln einer nackten und alleinstehenden Zahl ohne Einordnung in ein Referenzsys-
tem nicht das Ziel sein kann, soll hier versucht werden, eine Abstufung der verschiede-
nen 'Grade' der Digitalisierung zu definieren.
Der Computereinsatz wurde anhand der in Kapitel 3.3 definierten Themengebieten in
den darauf folgenden Kapiteln erläutert. Dabei wurden die Einsatzgebiete nach ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung wie auch ein Stück weit ihrer Komplexität nach hierarchi-
siert. Das Ziel der nun folgenden Datenermittlung soll sein, herauszufinden, auf welcher
der fünf Hierarchiestufen die Schweizer Architekturbüros sich einordnen lassen:
1. Zeichnen von zweidimensionalen, vektoriellen Plänen
2. Aufbau von dreidimensionalen, geometrischen, Modellen
3. Einsatz von Parametrisierung als Entwurfsmittel
4. Benutzen der Gebäudemodelle zur Bauteilproduktion bzw. zum Modellbau
5. Durchgehende Digitalisierung mittels 'Building Information Modeling'

Datenermittlung 48
——————————————————————————————————————————
4 Datenermittlung
4.1 Online-Umfrage
4.1.1 Definition der Untersuchungseinheiten
Gemäss den Daten des SIA65 gibt es in der Schweiz 9'578 Architektur- und 9'135 Inge-
nieurbüros (Stand 2005). Von diesen 18'713 Büros sind 2'575 Firmenmitglieder im
grössten Berufsverband der Architekten und Ingenieure, dem SIA. Dies entspricht einer
Quote von 13.7 Prozent. 13'037 Einträge im Telefonbuch66 zum Begriff „Architekturbü-
ro“ lassen eine leicht steigende Tendenz für das Jahr 2009 erkennen, auch im Wissen um
eventuelle Mehrfachnennungen oder Büros mit mehreren Standorten.
Die erwähnten 9'578 Architekturbüros beschäftigen rund 33'716 Personen, was einem
Anteil von 0.86% aller Beschäftigten in der Schweiz entspricht (Stand 2005). Die 9'125
Ingenieurbüros beschäftigen 48'113 Personen. Trotz der arithmetischen Durchschnitts-
grösse von 3.5 Beschäftigten pro Architekturbüro bzw. 5.2 Beschäftigten pro Ingenieur-
büro verteilen sich diese sehr unterschiedlich. Aus nachstehender Abbildung ist ersicht-
lich, dass fast 70% aller Betriebe lediglich 1 oder 2 Beschäftigte aufweisen. Büros mit
mehr als 50 Angestellten beschäftigen zwar rund 11% aller Architekten und Ingenieure,
machen in ihrer Anzahl jedoch lediglich 0.4% aus. Es kann deshalb festgehalten wer-
den, dass sehr viele kleine und wenig grosse Büros die Schweizer Planungsszene prä-
gen.
Abbildung 21: Grössenklassengliederung der Schweizer Architektur- und Ingenieurbüros nach Büros und Mitarbeitern
65 <http://www.sia.ch/download/factsheet_buero.pdf>; Abrufdatum: 03.05.2009, 18.50 Uhr66 <http://tel.search.ch/>; Abrufdatum: 03.05.2009, 19.40 Uhr

Datenermittlung 49
——————————————————————————————————————————
Da mit wachsendem Stichprobenumfang die Genauigkeit zunimmt, eine repräsentative
Aussage über die Grundgesamtheit zu machen67, wird zuerst die minimale Grösse der
Stichprobe ermittelt68:
Grundgesamtheit (Anzahl Architekturbüros): N = 9'578
Konfidenzintervall (in Standardabweichungen bei einer Normalverteilung von 95%): z = 1.96
Verteilung der Antworten (Annahme): s = 50 %
Fehlerquote: e = 5 %
N • z2 • s2
Minimale Stichprobengrösse: n = –––––––––––––––––– = 370
e2 • (N-1) + k2 • s2
Mit einem angenommenen Konfidenzintervall von 95 % und einer Fehlerquote von 5 %
muss die Stichprobe mindestens 370 Büros umfassen, damit eine repräsentative Aussage
gemacht werden kann. Da die Umfrage mittels der öffentlich zugänglichen E-Mail-
Adressen der rund 1'200 Architekturbüros, welche beim SIA als Firmenmitglieder ein-
geschrieben sind, durchgeführt wird, braucht es hierbei eine Rücklaufquote von rund
31 %.
Aus folgender Tabelle ist ersichtlich, dass von den 1'269 beim SIA eingeschrieben Fir-
menmitgliedern 1'199 für die Umfrage in Frage kommen. Die fehlenden 70 Büros teilen
sich in etwa gleichmässig auf in Büros mit mehreren Standorten im gleichen Kanton
und Büros mit fehlender E-Mail-Adresse. Ob die besagten 70 Büros ihre E-Mail-Adres-
se aus Datenschutzgründen nicht angaben oder ob sie bewusst über keine verfügen
(Technikabstinenz), lässt sich nicht eruieren.
Abbildung 22: SIA Firmenmitglieder nach Kantonen / für die Online-Umfrage taugliche Büros
67 Vgl. Bortz (2006) S. 419 ff.68 <http://de.wikipedia.org/wiki/Stichprobe> / <http://www.raosoft.com/samplesize.html>; Abrufdatum:
12.05.2009, 23.00 Uhr

Datenermittlung 50
——————————————————————————————————————————
Gemäss Auskunft des SIA verfügt der Verein über eine sehr heterogene und differen-
zierte Mitgliederstruktur. Grosse, international tätige Büros, wie auch Ein-Personen-Un-
ternehmen finden sich unter den Mitgliedern. Es werden deshalb folgende zwei grundle-
genden Annahmen getroffen:
Annahme 1:
Die 1'200 für die Online-Umfrage ausgewählten Büros (SIA-Firmenmitglieder) bilden
eine repräsentative Auswahl aus allen rund 9'600 in der Schweiz als Architekturbüros
tätigen Firmen. (Die Stichprobengrösse von 1'200 hat bei einer Grundgesamtheit von
9'600 und einem Konfidenzintervall von 95% eine Fehlerquote von ± 2.65%)
Annahme 2:
Da über 97% der im SIA eingeschriebenen Architekturbüros über eine E-Mail Adresse
verfügen und die besagten Büros eine repräsentative Stichprobengrösse darstellen (An-
nahme 1), werden die Büros ohne E-Mail-Adressen für die Umfrage vernachlässigt.
4.1.2 Definition der Untersuchungsmerkmale
Die Datenerhebung wird mittels einer Online-Umfrage durchgeführt. Per E-Mail wer-
den die rund 1'200 im SIA vertretenen Firmenmitglieder (Architekturbüros) angeschrie-
ben und gebeten, sich via einem beiliegenden Link an der Umfrage zu beteiligen. Wie
aus früher durchgeführten Umfragen bekannt wurde69, kann mit der zunehmenden Ver-
fügbarkeit des Internets und der Computerisierung eine gewisse Sättigungserscheinung
bezüglich Online-Umfragen festgestellt werden. Nichtsdestotrotz soll an dieser Stelle
versucht werden, dank einer relativ hohen Zahl von öffentlich zugänglichen E-Mail-
Adressen eine hohe Rücklaufquote zu erreichen, welche repräsentative Aussagen zu den
gestellten Fragen zulässt. Sozusagen als Belohnung wird denjenigen Büros, welche sich
an der Umfrage beteiligen, die Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit als PDF zu-
gestellt.
Die relevanten Fragen der Online-Datenerhebung lassen sich in folgende Bereiche un-
terteilen:
- Generelle Informationen: Die hier gestellten Fragen sollen Angaben zur Grösse und
zum Betätigungsfeld des Büros liefern. Die Frage nach der Bürogrösse dient als Quer-
vergleich mit den Daten des Bundesamtes für Statistik (Abbildung 21, Seite 48: Grös-
senklassengliederung) und zur Untermauerung der Annahme 1 (Repräsentativität der
Stichprobengrösse in Relation zur Grundgesamtheit).
69 Vgl. Samuelson (2008) S. 3

Datenermittlung 51
——————————————————————————————————————————
- Zugang zu Computern und Kommunikationsmitteln: Hier interessieren vor allem die
Anzahl der im Einsatz stehenden Computer, der Zugang der Mitarbeiter zu einer eige-
nen E-Mail-Adresse sowie die Verbindungsgeschwindigkeit des Büros zum Internet.
- Allgemeiner Computereinsatz: Die Fragen in diesem Bereich zeigen auf, inwiefern Ar-
chitekten den Computer für heutzutage übliche Büroarbeiten einsetzen.
- Architektenspezifischer Computereinsatz: Als eigentlicher Kern der Umfrage gedacht,
soll hier herausgefunden werden, ob und in wie weit die Architekten den Tuschestift ge-
gen digitale Instrumente eingetauscht haben.
- Zusammenarbeit und Netzwerke: Da die Bauplanung kein Arbeiten im stillen Käm-
merchen (mehr) ist, wird hier die Frage nach der firmenübergreifenden Zusammenarbeit
gestellt.
- Vor- und Nachteile der zunehmenden Digitalisierung: Hier sollen die konkreten Vor-
und Nachteile des zunehmenden Computereinsatzes in der Baubranche für die beteilig-
ten Architekturbüros eruiert werden.
- Zukünftige Investitionen im IT-Bereich und deren Motivation: Als Abschluss der Um-
frage und als Ausblick bezüglich des Einsatzes neuer Methoden und Technologien wird
hier nach den geplanten Investitionen im IT-Bereich gefragt. Zudem soll ermittelt wer-
den, welche (externen) Gründe die Büros zu einem verstärkten Einsatz neuer digitaler
Arbeitsmittel motivieren könnte.
4.1.3 Frageliste und Antwortmöglichkeiten
Generelle Informationen
1. Bürogrösse: Wie viele Personen arbeiten derzeit in Ihrem Büro? (Bei Büros mit mehreren Standorten: Anzahl Personen am aktuellen Standort)
(Antwort: Zahl)
2. Welches sind die Kernkompetenzen Ihres Büros?
(Antwort: Mehrfachauswahl zwischen: Strategische Planung, Bauherrenberatung, Entwurf, Visualisierungen, Kostenplanung, Ausführungsplanung, Bauleitung, Ande-re Kompetenzen: eigener Eintrag)
Zugang zu Computern und Kommunikationsmitteln
3. Wie viele Computer haben Sie derzeit in Ihrem Büro im Einsatz?
(Antwort: Zahl)

Datenermittlung 52
——————————————————————————————————————————
4. Verfügt Ihr Büro über eine regelmässig aktualisierte Homepage?
(Antwort: ja/nein)
5. Wie viele Ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Frage 1) verfügen über eine ei-gene E-Mail-Adresse? (Bei Büros mit mehreren Standorten: Anzahl Personen am aktuellen Standort)
(Antwort: Zahl)
6. Wie hoch ist die Verbindungsgeschwindigkeit Ihres Internetanschlusses? (Falls nicht bekannt, kann durch Klicken auf folgenden Link: www.speedtest.ch die Verbindungsgeschwindigkeit gemessen werden.
(Antwort: < 56 kbps (analog) / 56 - 128 kbps (ISDN) / 128 – 5'000 kbps (ADSL) / > 5'000 kbps (VDSL) / Unbekannt)
Allgemeiner Computereinsatz
7. Für welche der folgenden Bereiche werden in Ihrem Büro wie oft Computer eingesetzt?
(Antworten: Auswahlmatrix mit je vier Auswahlmöglichkeiten: 1 (noch nie), 2 (mind. schon einmal), 3 (meistens), 4 (immer)
a) Textverarbeitung und Tabellenkalkulation
b) Termin- und Ressourcenplanung
c) Kostenplanung
d) Produktrecherche im Internet
Architektenspezifischer Computereinsatz
8. Wie viele CAD-Programme benutzen Sie in Ihrem Büro?
(Antwort: 0, 1, 2, >2)
9. In welcher Form setzen Sie CAD-Programme ein?
(Antworten: Auswahlmatrix mit je vier Auswahlmöglichkeiten: 1 (noch nie), 2 (mind. schon einmal), 3 (meistens), 4 (immer)
a) Geometrisches Zeichnen von 2D-Plänen
b) Parametrisiertes Entwerfen
c) Digitale 3D-Modelle zur Entwurfskontrolle
d) Digitale 3D-Modelle für Visualisierungen
e) Digitale 3D-Modelle zur Herstellung von physischen Modellen

Datenermittlung 53
——————————————————————————————————————————
f) Digitale 3D-Modelle zur Herstellung von Bauteilen
g) Einsatz von Building Information Modeling
Zusammenarbeit und Netzwerke
10. In welcher Form arbeiten Sie mit andern Planern und/oder Unternehmern zu-sammen?
(Antworten: Auswahlmatrix mit je vier Auswahlmöglichkeiten: 1 (noch nie), 2 (mind. schon einmal), 3 (meistens), 4 (immer)
a) Versand von Papierplänen auf dem Postweg
b) Datenaustausch via E-Mail
c) Internet-Telefonie (VoIP)
d) Videokonferenzen
e) Projekträume/Planplattformen mit gesteuerten Zugriffsrechten
f) Interaktives, interdisziplinäres und örtlich verteiltes Arbeiten an einem gemein-samen Gebäudemodell mit koordiniertem Datenfilesaustausch
g) Interaktives, interdisziplinäres und örtlich verteiltes Arbeiten an einem gemein-samen Gebäudemodell mit zentraler oder verteilter Datenbank
Vorteile und Nachteile der zunehmenden Digitalisierung
11. Welche Vorteile sehen Sie für Ihr Büro in der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt des Architekten?70
(Antworten: Auswahlmatrix mit je vier Auswahlmöglichkeiten: 1 (Stimme voll zu) / 2 (Stimme eher zu) / 3 (Stimme eher nicht zu) / 4 (Stimme überhaupt nicht zu)
- Einfacher und schneller Zugriff auf gemeinsame Informationen
- Bessere finanzielle Kontrolle
- Schnelleres Arbeiten
- Ortsungebundenes Arbeiten
- Bessere Qualität der eigenen Arbeit
- Bessere Kommunikation
- Einfachere Handhabung grösserer Datenmengen
- Grössere Flexibilität bezüglich Kundenwünschen
- Weniger Planungskosten
- Weniger Personal nötig
- (Eingabe eigener Vorteile)
70 Vgl. Samuelson (2008), S. 15-16

Datenermittlung 54
——————————————————————————————————————————
12. Welche Nachteile sehen Sie für Ihr Büro in der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt des Architekten?71
(Antworten: Auswahlmatrix mit je vier Auswahlmöglichkeiten: 1 (Stimme voll zu) / 2 (Stimme eher zu) / 3 (Stimme eher nicht zu) / 4 (Stimme überhaupt nicht zu)
- Hoher und permanenter Aufwand für Hard- und Software (Upgrading)
- Gefahr der Informationsüberflutung
- „Veränderungen sind unnötig, da bis anhin alles zufriedenstellend lief“
- Personal benötigt mehr Know-How
- Zu hohe Investitions-, Schulungs- und Trainingskosten
- Risiko, dass zu viel Computereinsatz zu Ineffizienz führt
- Nichtkompatibiliät der Software
- Bestehende Prozesse und Ordnungen verhindern eine sinnvolle Digitalisierung
- Verminderte Datensicherheit
- Keine einheitlichen Standards (proprietäre Software)
- (Eingabe eigener Nachteile)
Zukünftige Investitionen im IT-Bereich und deren Motivation
13. In welchen IT-Bereichen sehen Sie am ehesten Bedarf für (mögliche) Investitio-nen in den nächsten 1 bis 3 Jahren?72
(Antworten: Auswahlmatrix mit je vier Auswahlmöglichkeiten: 1 (Stimme voll zu) / 2 (Stimme eher zu) / 3 (Stimme eher nicht zu) / 4 (Stimme überhaupt nicht zu)
- CAD-Software für das Erstellen von 2D-Plänen
- CAD-Software für das Erstellen von 3D-Modellen
- Informationsmanagement (Management von Modellen, Varianten und Versionen)
- Projektspezifische Netzwerke (Planplattformen etc.)
- Building Information Modeling
- Informationssuche im Internet zur Unterstützung der täglichen Arbeit
- Projektmanagement, Projektsteuerung
- Kostenplanungs- / Kostenkontrollsysteme
- Mobile Computersysteme
- Virtual Reality
- (Eingabe eigener Bereiche)
71 Vgl. Samuelson (2008), S. 15-1672 Vgl. Samuelson (2008), S. 17

Datenermittlung 55
——————————————————————————————————————————
14. Welche externen Gründe würden Sie motivieren, die oben genannten Investi-tionen zu tätigen?
(Antworten: Auswahlmatrix mit je vier Auswahlmöglichkeiten: (0) Stimme voll zu / (1) eher zu / (2) eher nicht zu / (3) überhaupt nicht zu)
- Der Auftraggeber wünscht eine durchgehende Gebäudemodellierung.
- Die Baubewilligung wird nur noch auf Grund von 3D-Modellen erteilt.
- Die Fachplaner arbeiten interaktiv am gleichen digitalen Modell.
- Alle CAD-Programme basieren auf einem durchgängig kompatiblen Format.
- Das digitale 3D-Modell wird weiterbenutzt für Bewirtschaftung, Sanierung etc..
- Vereinfachte Ableitung von gebäudetechnischen Nachweisen (Minergie® etc.).
- Junge Mitarbeiter beherrschen die neuen Techniken.
- Visualisierungen können jederzeit selber erstellt werden.
- Spezielle Interfaces ermöglichen ein Entwerfen im digitalen Raum.
- 3D-Modelle von gebauten Objekten sind öffentlich zugänglich (OpenSource).
- (Eingabe eigener Gründe)
4.1.4 Durchführung der Umfrage
Die 1'199 Büros wurden am 16. Juni gestaffelt in zehn Blöcken zu je 90 bis 160 Büros
per E-Mail73 angeschrieben und gebeten, sich via nachfolgenden Link der Umfrage zu
beteiligen. Aus verschiedenen Gründen (Ferienabwesenheit, bewusste falsche Angabe
der E-Mail-Adressen, etc.) konnten 33 Mails den Empfänger nicht erreichen. Insgesamt
wurde die Einladung 1'166 Büros erfolgreich zugestellt. Die Umfrage ist (war) unter
folgendem Link zu finden:
<http://www.i4ds.ch/de/survey/digitalisierungsgrad.html>
Innert den ersten 48 Stunden haben schon rund 200 Vertreter der angeschriebenen Büros
die Fragen beantwortet. Die Umfrage lief während drei Wochen. Bis zum 10. Juli 2009
haben insgesamt 230 unterschiedliche74 Büros die Fragen beantwortet. Die Rücklauf-
quote beträgt somit rund 19 %, an Stelle der erhofften 31%75. Auf die veränderte statisti-
sche Aussagekraft wird später eingegangen.
73 Wortlaut des E-Mails: Siehe Anhang A74 Dies lässt sich aus den unterschiedlichen IP-Adressen schliessen.75 Siehe Kapitel 4.1.1

Datenermittlung 56
——————————————————————————————————————————
4.2 Datenauswertung und Datenanalyse
Die in den Kapiteln 4.1.2 und 4.1.3 definierten Fragen wurden wie schon geschildert
den anfangs erwähnten Büros mittels einer Online-Umfrage gestellt. Folgende Antwor-
ten kamen dabei zu Tage (Die nachfolgenden Kapitel wurden in die in der Umfrage be-
nutzten Bereiche unterteilt):
4.2.1 Generelle Informationen
1. Bürogrösse: Wie viele Personen arbeiten derzeit in Ihrem Büro? (Bei Büros mit meh-reren Standorten: Anzahl Personen am aktuellen Standort)
≤ 2 Mitarbeiter : 44 Büros 19.1 %3 – 4 Mitarbeiter : 45 Büros 19.6 %5 – 9 Mitarbeiter : 63 Büros 27.4 %10 – 19 Mitarbeiter : 48 Büros 20.9 %20 – 49 Mitarbeiter : 26 Büros 11.3 %50 – 99 Mitarbeiter : 4 Büros 1.7 %100 – 499 Mitarbeiter : 0 Büros 0.0 %––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Total : 230 Büros 100 %
2. Welches sind die Kernkompetenzen Ihres Büros? (in absteigender Reihenfolge)
Ausführungsplanung : 214 Büros 93.0 %Entwurf : 212 Büros 92.2 %Bauleitung : 166 Büros 72.2 %Kostenplanung : 149 Büros 64.8 %Bauherrenberatung : 137 Büros 59.6 %Strategische Planung : 115 Büros 50.0 %Visualisierungen : 62 Büros 27.0 %
Andere (eigene Eingabe)
Schätzungen / Expertisen : 6 Büros 2.6 %Energieberatung : 5 Büros 2.2 %Projektentwicklung : 4 Büros 1.7 %Wettbewerbsbegleitung : 3 Büros 1.3 %Raum- / Siedlungsplanung : 3 Büros 1.3 %Generalunternehmung : 2 Büros 0.9 %Städtebau : 2 Büros 0.9 %
Vergleicht man die Bürogrössen der Frage 1 mit der Grössenklassengliederung des SIA
und des BfS76, so ist klar ersichtlich, dass die teilnehmenden Büros bezüglich der An-
zahl Mitarbeiter erstaunlicherweise nicht gut mit der Grundgesamtheit übereinstimmen.
76 Siehe Abbildung 21 in Kapitel 4.1.1, Seite 48

Datenermittlung 57
——————————————————————————————————————————
Der SIA bzw. die Daten des BfS zeigen ein Hauptgewicht bei der kleinsten Bürogrösse
(≤ 2 Mitarbeiter), während die Online-Umfrage einen Medianwert im Bereich der Büro-
grösse 5-9 Mitarbeiter ergab. Als Erklärung hierfür sind folgende vier Gründe denkbar:
Erstens stammen die Daten des SIA-Factsheets aus dem Jahre 2001. Die wirtschaftliche
Lage der Architekten von 2001 kann nicht mit der von 2009 gleichgesetzt werden, zu-
mal die Architekturbüros einer relativ hohen Fluktuation von Mitarbeitern unterliegen,
nach unten und nach oben. Teilweise werden Mitarbeiter projektspezifisch eingestellt,
was die Bürogrösse noch mehr von der Konjunktur der Planungs- und Baubranche ab-
hängig macht.
Zweitens wurde diese Umfrage, welche das Ziel hat, den Digitalisierungsgrad der Büros
zu ermitteln, lediglich den SIA-Firmenmitgliedern zugestellt. Architekten, die in bzw.
als Ein-Personen-Büros arbeiten, fassen vermutlich aus Kostengründen eher eine Ein-
zelmitgliedschaft des SIA ins Auge als eine Firmenmitgliedschaft. Aus diesem Grunde
sind Ein-Personen-Büros bei den Firmenmitgliedern weniger stark vertreten als in der
freien Wildbahn.
Ein dritter Grund kann in der Verlockung gesehen werden, das eigene Büro in einem
besseren Licht erscheinen zu lassen als es tatsächlich der Fall ist. Der Begriff Mitarbei-
ter wird in der Frage nicht näher definiert, so dass man auch Teilzeitangestellte mit we-
nigen Stellenprozenten oder freie Mitarbeiter unter dem Begriff subsumiert. Diese Hal-
tung verlagert den Durchschnitt der Bürogrösse zwangsläufig nach oben.
Als letzter Grund muss die statistische Unschärfe mit in Betracht gezogen werden, ins-
besondere da wegen der tieferen Rücklaufquote auch die Fehlerquote höher ausfällt als
erwartet.
Erwartungsgemäss stark vertreten sind in der Frage 2 die beiden klassischen Kernkom-
petenzen Ausführungsplanung und Entwurf, gefolgt von Bauleitung und Kostenpla-
nung. Als erstaunlich hoch kann die Zahl derer angesehen werden, welche sich den Be-
griff 'strategische Planung' auf die Fahne geschrieben haben. Interessant zu erfahren
wäre, was genau und was die Betreffenden jeweils nicht unter dem Begriff verstehen.
Dass das Gebiet der Projektentwicklung nur marginal vertreten ist, hat sicherlich damit
zu tun, dass der Begriff selber eingegeben werden musste, da er nicht im Auswahlmenü
vorkam. Trotz des grossen Angebots an professionellen Visualisierungsbüros zählen
noch rund ein Viertel der Büros das bildgenerierende digitale Darstellen von Projekten
zu ihren Hauptaufgaben. Tendenziell zunehmen werden seitens der Planer die beraten-
den Tätigkeiten, sei es bezüglich Strategie, Energie oder der Durchführung von Wettbe-
werben.

Datenermittlung 58
——————————————————————————————————————————
4.2.2 Zugang zu Computern und Kommunikationsmitteln
3. Wie viele Computer haben Sie derzeit in Ihrem Büro im Einsatz?
≤ 2 Computer : 19 Büros 8.3 %3 – 4 Computer : 47 Büros 20.4 %5 – 9 Computer : 77 Büros 33.5 %10 – 19 Computer : 54 Büros 23.5 %20 – 49 Computer : 29 Büros 12.6 %50 – 99 Computer : 4 Büros 1.7 %100 – 499 Computer : 0 Büros 0.0 %––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Total : 230 Büros 100 %
< 1 Computer pro Mitarbeiter : 15 Büros 6.5 %1 Computer pro Mitarbeiter : 86 Büros 37.4 %> 1 Computer pro Mitarbeiter : 129 Büros 56.1 %
4. Verfügt Ihr Büro über eine regelmässig aktualisierte Homepage?
164 Büros (71.3 %) verfügen über eine regelmässig aktualisierte Homepage.
5. Wie viele Ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Frage 1) verfügen über eine eigene E-Mail-Adresse? (Bei Büros mit mehreren Standorten: Anzahl Personen am aktuellen Standort)
keine Angabe : 5 Büros 2.2 %≤ 2 E-Mail-Adressen : 64 Büros 27.8 %3 – 4 E-Mail-Adressen : 39 Büros 17.0 %5 – 9 E-Mail-Adressen : 48 Büros 20.8 %10 – 19 E-Mail-Adressen : 45 Büros 19.6 %20 – 49 E-Mail-Adressen : 25 Büros 10.9 %50 – 99 E-Mail-Adressen : 4 Büros 1.7 %100 – 499 E-Mail-Adressen : 0 Büros 0.0 %––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Total : 230 Büros 100 %
6. Wie hoch ist die Verbindungsgeschwindigkeit Ihres Internetanschlusses? (Falls nicht bekannt, kann durch Klicken auf folgenden Link: www.speedtest.ch die Verbindungs-geschwindigkeit gemessen werden.
Unbekannt / Keine Angabe : 26 Büros 11.3 %< 128 kbps (analog / ISDN) : 10 Büros 4.3 %128 – 5'000 kbps (ADSL) : 135 Büros 58.7 %> 5'000 kbps (VDSL) : 59 Büros 25.7 %––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Total : 230 Büros 100 %

Datenermittlung 59
——————————————————————————————————————————
Die Anzahl der im Einsatz stehenden Rechner bewegt sich sehr ähnlich mit der Anzahl
Mitarbeiter. Währenddem kleinere Büros leicht mehr Rechner haben als grössere Büros,
so verfügten grössere Büros tendenziell über mehr E-Mail-Adressen als Mitarbeiter,
bzw. als ihre kleineren Konkurrenten. Dies ist in folgender Abbildung ablesbar. Sie zeigt
auf, wie sich die Gesamtmenge der Mitarbeiter, der Computer und der benutzten E-
Mail-Adressen auf die Grössen der befragten Büros aufteilen. Beispielsweise verfügen
Büros mit fünf bis neun Mitarbeitern über ca. 18% der Gesamtanzahl an Mitarbeitern
und ebenfalls ca. 18% der Computer, jedoch nur ca. 15% der E-Mail-Adressen.
Abbildung 23: Aufteilung der Gesamtanzahl Mitarbeiter, Computer und E-Mail-Adressen nach Bürogrös-se gegliedert
Die projektbedingte höhere Fluktuation an festen und freien Mitarbeitern veranlasst die
Büroinhaber, jedem Mitarbeiter mindestens einen Rechner zur Verfügung zu stellen,
welcher dann aber bei der Beendigung eines Projektes, bzw. wenn der Mitarbeiter die
Firma verlässt, meistens nicht verkauft wird. Dieser Effekt tritt bei grösseren Büros we-
niger zu Tage. Mit zunehmender Bürogrösse erhöht sich erfahrungsgemäss auch die Ar-
beitsteilung; Mitarbeiter, welche als Praktikanten oder Modellbauer eingestellt werden,
verfügen nicht zwingend über einen eigenen Rechner.
Fast drei Viertel der Büros verfügen über einen eigenen Webauftritt. Eine weitere inter-
essante Frage wäre, wie oft die Homepage aktualisiert wird, da es doch einige Büros
gibt, die eine Homepage nach deren Erstellung nicht mehr aktiv bewirtschaften. Die
Verbindungsgeschwindigkeit mit dem Internet ist mit einer ADSL-Leitung heute gut ge-
währleistet.
Generell kann festgehalten werden, dass in einem Architekturbüro heute ein Computer
und eine eigene E-Mail-Adresse zur Standardausrüstung eines zeitgemässen Arbeits-
platzes gehören. Diese Aussage deckt sich mit der im Jahre 2008 in Schweden durchge-

Datenermittlung 60
——————————————————————————————————————————
führten Umfrage 'The IT-Barometer'77. Die Infrastruktur der Schweizer Architekturbüros
ist sehr gut ausgebaut. Eine genügende Anzahl Rechner ist mit einer akzeptablen Ge-
schwindigkeit miteinander und mit dem Internet verbunden. Die grundlegenden Beding-
ungen für eine effiziente Zusammenarbeit sind somit vorhanden.
4.2.3 Allgemeiner Computereinsatz
7. Für welche der folgenden Bereiche werden in Ihrem Büro wie oft Computer einge-setzt?
Noch Mind. Meistens Immer Keine nie schon 1x Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Textverarbeitung und Tabellenkalkulation 1 4 19 205 1
Termin- undRessourcenplanung 5 15 80 130 0
Kostenplanung 5 8 46 167 4
Produktrecherche im Internet 1 8 97 123 1
(Die schwarzen Punkte ( ) stellen den geometrisch gewichteten Mittelwert dar).
Ebenso stark wie die Büros mit leistungsfähiger Hardware ausgerüstet sind, werden
klassische Büroprogramme eingesetzt. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Kos-
tenplanung erfolgen praktisch immer am Rechner. Bei der Termin- und Ressourcenpla-
nung wird der Papierkalender vermehrt verdrängt vom interaktiven digitalen Terminpla-
ner. Ebenso erfolgen Produktrecherchen bequemer online als beispielsweise per Post.
Erfreulich ist hier die Tatsache, dass nur ganz wenige Büros keine Angaben machten,
verglichen mit späteren Fragen. Schweizer Architekturbüros unterscheiden sich
hinsichtlich der Verwendung von allgemeiner Bürosoftware nicht von andern
Dienstleistungsbetrieben.
77 Vgl. Samuelson (2008), S. 4

Datenermittlung 61
——————————————————————————————————————————
4.2.4 Architektenspezifischer Computereinsatz
8. Wie viele CAD-Programme benutzen Sie in Ihrem Büro?
keines 1 2 > 2 Keine Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anzahl CAD-Programme 2 110 43 38 37
9. In welcher Form setzen Sie CAD-Programme ein?
Noch Mind. Meistens Immer Keine nie schon 1x Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Geometrisches Zeichnenvon 2D-Plänen 3 4 35 180 8
Parametrisiertes Entwerfen 56 45 57 41 31
Digitale 3D-Modelle zur Kontrolle des Entwurfes 28 69 75 44 14
Digitale 3D-Modelle für Visualisierungen 26 58 88 48 10
Digitale 3D-Modelle zur Herstellungvon physischen Modellen 117 56 22 9 26
Digitale 3D-Modelle zur Herstellungvon Bauteilen 148 47 7 4 24
Einsatz von Building InformationModeling (BIM) 175 21 4 3 27
Die erwähnte Untersuchung in Schweden brachte zu Tage, dass mehr als 90 Prozent der
schwedischen Architekturbüros im Jahre 2008 CAD-Systeme einsetzten78. Gemäss den
Antworten der Frage 8 kann bei uns von einem ähnlich hohen Prozentsatz ausgegangen
werden.
Die Frage 9 als eines der Kernstücke der Umfrage soll aufzeigen, in welcher Form und
in welchem Umfang das architektenspezifische Werkzeug des CAD tatsächlich einge-
setzt wird. Erwartungsgemäss nutzen praktisch alle Büros den Rechner als digitales Zei-
chenbrett zur Herstellung von zweidimensionalen Plänen. Bei den Anwendungen rund
78 Vgl. Samuelson (2008), S. 8

Datenermittlung 62
——————————————————————————————————————————
um das parametrisierte Entwerfen zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Es ist zu vermu-
ten, dass der Begriff für viele unklar ist. Indem man im CAD-Programm einen Wert
(Beispielsweise die Höhe einer Mauer) eingibt, kann man noch nicht von Parametrisie-
rung im Sinne einer von der Geometrie losgelösten, objektbasierten Datenbearbeitung
sprechen. Diese vermutete Unsicherheit widerspiegelt sich ebenfalls in der relativ gros-
sen Anzahl Büros, welche zu dieser Frage keine Antwort abgaben. Die sieben Fragenbe-
reiche der Frage 9 sind in einer logischen Abfolge, gemäss ihrem Grad der Digitalisie-
rung geordnet. Hier ist zu überlegen, ob der Bereich der Parametrisierung wirklich di-
rekt nach dem zweidimensionalen Planzeichnen einzuordnen ist, oder ob parametrische
Entwürfe nach den dreidimensionalen Modellen anzusiedeln wären. Eventuell wäre so
die Aussagekraft klarer. Auf Grund der vielen leeren Antworten des nicht näher um-
schriebenen Begriffes und der Position der Frage innerhalb des Fragenkatalogs bleibt
das Resultat mit einer gewissen Unschärfe behaftet.
Der Aufbau von dreidimensionalen digitalen Modellen erfolgt in den meisten Büros
eher nebenbei, sei es als interne Überprüfung des eigenen Projektes oder für Präsenta-
tionen nach aussen in Form von Visualisierungen. Mittlerweile bietet eine wachsende
Anzahl von professionellen Visualisierungsbüros Renderings in einer hohen Qualität zu
fairen Preisen an, so dass solche Aufgaben in Büros auch gerne extern vergeben werden.
Noch weniger verbreitet als die Visualisierungen ist der Einsatz von Rapid Prototyping
bzw. das Weiterleiten der eigenen Projektmodelle auf Modellbaumaschinen. Dies hat si-
cherlich auch damit zu tun, dass der digitale Modellbau erst seit einigen wenigen Jahren
an den Hochschulen (beispielsweise der ETH) eine breite Anhängerschaft unter den Stu-
denten gefunden hat. Junge Mitarbeiter als Träger und Verbreiter neuer Technologien
werden die Arbeitsweise der Büros nachhaltig beeinflussen. Dies geschieht jedoch ver-
mutlich nicht abrupt, sondern eher in einem evolutionären Sinne. Büros, welche neue
Technologien geschickt einsetzen können, verfügen früher oder später über Marktvortei-
le gegenüber ihren Konkurrenten.
Unter den Architekten noch weniger verbreitet als die digitalen Modellbaumaschinen ist
die Verbindung der Modelle mit der Produktion von Bauteilen. Was in speziellen Berei-
chen wie dem Stahlbau oder teilweise auch im Holzbau heute schon Alltag ist, stellt in
der allgemeinen Bauplanung doch noch eine Ausnahmeerscheinung dar. Seit einigen
Jahren laufen an der ETH etliche Forschungsprojekte in diese Richtung 79. Es ist abseh-
bar, dass in einigen Jahren diese Frage zu andern Antworten führen wird.
Praktisch noch nicht vorhanden ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die vollständige
Digitalisierung der Planung mittels Building Information Modeling. Wie bei der Para-
79 Vgl. Gramazio / Kohler (2008)

Datenermittlung 63
——————————————————————————————————————————
metrisierung weist auch hier die leicht höhere Quote von leeren Antworten auf eine ge-
wisse Unsicherheit bezüglich des oft falsch verstandenen Begriffes BIM hin.
Die 2008 in Schweden durchgeführte ähnliche Untersuchung zeigte folgendes Bild:
Rund 10 Prozent der schwedischen Architekturbüros benutzen CAD-Systeme für die
Bearbeitung geometrischer 2D-Daten (Planzeichnungen), 60 Prozent für die Bearbei-
tung geometrischer 2D- und 3D-Daten (inkl. Entwurfskontrolle, Visualisierung etc.).
Rund 25 Prozent der Büros setzen CAD-Systeme ein, die über die geometrische Daten-
bearbeitung hinausgehen (objektbasierte Datenbanken). In diesem Sinne muss hier fest-
gehalten werden, dass die schwedischen Architekturbüros ihren Schweizer Kollegen
leicht voraus sind, insbesondere was die Arbeit mit nicht-geometrischen Daten anbe-
langt.
Der spezifische Computereinsatz der Schweizer Architekturbüros beschränkt sich im
Wesentlichen auf das Zeichnen von zweidimensionalen Plänen. Dreidimensionale Ge-
bäudemodelle werden, wenn überhaupt, lediglich zur Überprüfung des eigenen Entwur-
fes oder zur Visualisierung von Projekten eingesetzt. Praktisch noch nicht verbreitet ist
die weiterführende Verwendung der Gebäudemodelle für den digitalen Modellbau bzw.
die direkte Produktion von Bauteilen. Noch seltener findet man in schweizer Architek-
turbüros eine durchgehende digitale Planung mittels 'Building Information Modeling'.
4.2.5 Zusammenarbeit und Netzwerke
10. In welcher Form arbeiten Sie mit andern Planern und/oder Unternehmern zusam-men?
Noch Mind. Meistens Immer Keine nie schon 1x Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Versand von Papierplänen auf dem Postweg 6 97 105 14 8
Datenaustausch via E-Mail 1 5 132 91 1
Internet-Telefonie (VoIP) 183 21 11 7 8
Projekträume/Planplattformen mit gesteuerten Zugriffsrechten 95 73 48 10 4
Interaktives, interdisziplinäres, örtlich verteiltes Arbeiten an einem gemein-samen Gebäudemodell mit koordinier-tem Datenfilesaustausch 169 36 14 4 7

Datenermittlung 64
——————————————————————————————————————————
Interaktives, interdisziplinäres, örtlichverteiltes Arbeiten an einem gemein-samen Gebäudemodell mit zentraleroder verteilter Datenbank 193 18 6 6 7
Hinsichtlich der Digitalisierung ist erfreulicherweise festzustellen, dass die Zusammen-
arbeit mit andern Planern oder Unternehmern nicht mehr über den Umweg des per Post
verschickten Papierplanes von Statten geht. Gemäss eigener Erfahrung, wie auch aus
den Antworten zur zweiten Frage zu entnehmen ist, erfolgt der Datenaustausch gröss-
tenteils durch den Versand der CAD-Files per E-Mail. Trotz der vorhandenen Hardware
und der genügenden Leitungskapazität hat sich die Kommunikation via Internettelefonie
bei den Architekten noch nicht durchgesetzt. Teilweise schon Einzug in den Alltag ge-
halten hat das zentrale Ablegen der Daten in Projekträume oder auf Planplattformen mit
gesteuerten Zugriffsrechten. Ungefähr die Hälfte der befragten Büros gibt an, diese
schon mindestens einmal oder sogar mehrmals benutzt zu haben. Das gemeinsame, in-
teraktive Arbeiten der beteiligten Planer am gleichen Gebäudemodell, welches unterein-
ander ausgetauscht wird, fand bisher nur bei ca. einem Viertel der befragten Büros statt.
Erwartungsgemäss noch am wenigsten verbreitet unter den Planern ist das gemeinsame
Arbeiten einem Gebäudemodell, welches auf einer zentralen oder verteilten Datenbank
verwaltet wird.
4.2.6 Vorteile und Nachteile der zunehmenden Digitalisierung
11. Welche Vorteile sehen Sie für Ihr Büro in der zunehmenden Digitalisierung der Ar-beitswelt des Architekten?
Stimme Stimme Eher Stimme Keine voll zu eher zu nicht zu nicht zu Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Einfacher und schneller Zugriff zu gemeinsamen Informationen 171 53 3 0 3
Bessere finanzielle Kontrolle 72 107 41 9 1
Schnelleres Arbeiten 106 107 15 2 0
Ortsungebundenes Arbeiten 71 85 64 9 1
Bessere Qualität der eigenen Arbeit 55 127 37 10 1
Bessere Kommunikation 72 120 34 3 1

Datenermittlung 65
——————————————————————————————————————————
Einfachere Handhabung grössererDatenmengen 131 83 15 1 0
Grössere Flexibilität bezüglichKundenwünschen 80 117 30 3 0
Weniger Planungskosten 29 79 103 18 1
Weniger Personal nötig 29 81 103 15 2
Andere Vorteile (eigene Eingabe):
1) Aktualisierung und Optimierung von Kosten- und Planungsständen
2) Datenaustausch / Geschwindigkeit
3) Datenverwaltung (Zugriff auf archivierte Daten)
4) Bessere Archivierungsform und mehr Datensicherheit
5) Aktualisierte Planstände
6) Überblick und Zugriff auf vorhandenes Planmaterial
7) Jeder kann Zeichnen mit CAD, es braucht kein jahrelanges Training mehr
8) Kleinere Archivflächen nötig
9) Massgenauigkeit, Ergänzbarkeit, Abrufbarkeit
10) Neue Arbeitsinstrumente, veränderte Arbeitsweise
11) Optimierung ist deutlich einfacher
12) Reichhaltigere Variantenprüfung möglich
13) Sämtliche Planungsarbeiten erfolgen bei uns mit CAD-System, die Kommunikation und der Datenversand mit den Fachplanern erfolgen immer digital und per Mail. Bei Studien oder für Präsentationen sind physische (Massen-/Darstellungs-) Modelle un-entbehrlich. Das Problem beim CAD ist die effektive 3D-Wahrnehmung. Für die Übersicht/Kontrolle einer Planung sind ausgedruckte Pläne immer noch unschlagbar.
Die Abfolge der vorgeschlagenen Vorteile basiert auf der in Schweden durchgeführten
Umfrage80. Obwohl die erwähnten Untersuchungen (2000 und 2007) mit der vorlie-
genden Arbeit nicht direkt verglichen werden können, soll hier trotzdem versucht wer-
den, die in Skandinavien eruierten Vorteile denjenigen mit der Online-Umfrage in Er-
fahrung gebrachten Antworten gegenüberzustellen, im Wissen darum, dass so Arbeits-
weisen von Architekten aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Jahren ver-
glichen werden. Beabsichtigt ist weniger der präzise Vergleich, sondern eher das Erken-
nen von Tendenzen einer länderüberspannenden Planungsbranche.
80 Vgl. Samuelson (2008) und Samuelson (2002)

Datenermittlung 66
——————————————————————————————————————————
Die folgende Auflistung zeigt die angegebenen Antworten zu den Vorteilen der zuneh-
menden Digitalisierung der Arbeitswelt der Architekten gemäss ihrer Prioritätenfolge.
Skandinavien Schweden Schweiz Trend2000 2007 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Einfacher und schneller Zugriff zu gemeinsamen Informationen 2 1 1
Bessere finanzielle Kontrolle 1 2 6
Schnelleres Arbeiten 6 3 3
Ortsungebundenes Arbeiten 9 4 8
Bessere Qualität der eigenen Arbeit 7 5 7
Bessere Kommunikation 3 6 5
Einfachere Handhabung grössererDatenmengen 5 7 2
Grössere Flexibilität bezüglichKundenwünschen 8 8 4
Weniger Planungskosten 9 9 10
Weniger Personal nötig 10 10 9
Die Rangfolge der Vorteile der zunehmenden Digitalisierung in der Arbeitswelt der Ar-
chitekten ist in gewissen Bereichen ähnlich derer der erwähnten Untersuchungen in
Skandinavien. Spezifisch für die Schweiz traten Themen hervor wie das schnellere Ar-
beiten, die einfachere Handhabung grösserer Datenmengen oder die grössere Flexibilität
bezüglich Kundenwünschen. Weniger in Betracht fielen Argumente wie die bessere fi-
nanzielle Kontrolle oder eine bessere Kommunikation. Erstaunlicherweise gänzlich un-
beeindruckt sind die Architekten in allen befragten Ländern von Argumenten wie der
besseren Qualität der eigenen Arbeit, den geringeren Planungskosten oder dem weniger
benötigten Personal. In einem gewissen Sinne wird hier die den Büros unterstellte Tech-
nologieabstinenz (Arbeitshypothesen) ein Stück weit bestätigt. Marktwirtschaftliche
Themen wie Planungs- oder Personalkosten sind weniger ein Thema als das zielgerich-
tete Fokussieren auf die eigene Arbeit.
Erwähnenswert ist bei der eigenen Eingabe von Vorteilen das mehrmalige Auftreten des
Themas der Archivierung. Kontinuierlich fallende Preise für das Sichern und Aufbe-
wahren grosser Datenmengen ermöglichen ein einfaches und platzsparendes Archivie-

Datenermittlung 67
——————————————————————————————————————————
ren. Allerdings stellt sich hier die Frage nach der Lebensdauer der heutigen Da-
tenformate81.
12. Welche Nachteile sehen Sie für Ihr Büro in der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt des Architekten?
Stimme Stimme Eher Stimme Keine voll zu eher zu nicht zu nicht zu Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Hoher und permanenter Aufwand für Hard- und Software (Upgrading) 101 97 28 3 1
Gefahr der Informationsüberflutung 81 100 39 9 1
'Veränderungen sind unnötig, da bisanhin alles zufriedenstellend lief' 5 40 114 69 2
Personal benötigt mehr Know-How 67 126 28 6 3
Zu hohe Investitions-, Schulungs- und Trainingskosten 19 93 94 24 0
Nichtkompatibilität der Software 32 66 115 17 0
Bestehende Prozesse und Ordnungenverhindern eine sinnvolle Digitalisierung 6 45 140 34 5
Verminderte Datensicherheit 13 66 112 37 2
Keine einheitlichen Standards(proprietäre Software) 30 95 79 19 7
Andere Nachteile (eigene Eingabe):
1) Fähigkeiten wie Zeichnen von Hand kommen zu kurz bzw. verkümmern. Ein Stück Sinnlichkeit geht verloren (Arbeiten auf Papier mit Tusche, Farb- und Bleistift). Der Planungsprozess wird hektischer.
2) Überbewertung der Digitalisierung in Bezug auf die Qualität. Mitarbeiter haben Mühe mit der Massstäblichkeit der geforderten Pläne. Oft zu hoher Detaillierungsgrad, Inko-härenz zum effektiven Projektstand.
3) Das zeichnerische Handwerk und intellektuelle sowie manuelle Fertigkeiten gehen verloren (Rechnen, Modellbau) – dafür wird die grafische Vielfalt reicher.
4) Daten sind nicht über eine längere Zeit nutzbar. Unsere Zeit wird keine Originalinfor-mation an unsere Nachfahren weitergeben, weil es keine physischen Archive mehr gibt = grosser kultureller Verlust, den wir nicht abschätzen können.
81 Siehe auch Antwort Nr. 12 (eigene Angaben) zu Frage 12, Seite 68

Datenermittlung 68
——————————————————————————————————————————
5) Die Arbeit geht zwar schneller, dafür werden Leistung und Qualität zum gleichen Preis viel höher... eher für den Kunden eine Verbesserung, als für den Architekten.
6) Ausbildung und Arbeit haben sich mit der EDV stark verändert, wir haben keine Hochbauzeichner mehr, nur noch Architekten. Die EDV ist heute eine Notwendigkeit, der Umgang muss gelernt und verantwortungsvoll sein (z.B. Informationsflut). Sämtli-che Programme sind in ständiger Entwicklung, meistens folgen Verbesserungen. Die Kommunikation zwischen Planern und zwischen unterschiedlichen Systemen/Pro-grammen ist heute nur noch in geringem Masse ein Problem (3D-Modelle).
7) Die Fähigkeit zur 'Übersicht' in allen Bau- und Entwurfsfragen nimmt stetig ab, unter-stützt durch die dauernde Störung durch SMS, E-Mail, etc.
8) Die höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit, welche die Digitalisierung suggeriert, ist eine grosse Fehlerquelle.
9) Der Einführungsaufwand ist erheblich und in der Folge lohnend.
10) Grosser personeller Aufwand, weil wenn nicht immer auf dem aktuellsten Stand, dann nicht optimal.
11) Körperlich sehr einseitige Belastung für alle Arbeitenden (besonders Augen / Rücken), zunehmende psychische Belastung durch sehr einseitige Tätigkeit. Arbeiten stellen hö-here Ansprüche an intellektuelle Fähigkeiten (wenig Hilfsjobs können angeboten wer-den). Frage: Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft weiter, besonders für die, die we-niger intellektuelle Fähigkeiten besitzen – 'Problem Gesellschaftsbruch'.
12) Keine zuverlässig langfristige Datenarchivierung (30 Jahre und mehr). Zu grosser Aufwand durch falsche Priorisierung von unwichtigen Details.
13) Mitarbeiter ist sehr gut im konventionellen Zeichnen, der beim Zeichnen auch kon-struiert. Umstellung auf CAD wäre ineffizient (Jg. 1961).
14) Mitarbeiter neigen dazu, ihre Arbeit weniger zu strukturieren, alles in einem Gang zu lösen. Dies führt oft zu Zeitinvestitionen, wo diese gar nicht nötig sind und so zu grös-serem Zeitaufwand.
15) Monotonie beim Arbeiten. Jeder sitzt den ganzen Tag an seinem Bildschirm. Ev. ge-sundheitlich negative Folgen.
16) Verlust der Fähigkeit zur Abstraktion, die frühe realitätsnahe Darstellung ist der Phan-tasie abträglich.
17) Oftmals wird zu wenig gedacht und zu viel gezeichnet.
18) Permanentes Arbeiten am Computer, zu wenig Wechsel des Arbeitsinstrumentes (Skiz-zieren etc.) vermindert den Überblick.
19) Spontane Diskussion über die Arbeit findet nicht mehr statt (Pläne auf Tischen sind einfacher anzuschauen und laden mehr zur Diskussionen ein als CAD-Ausschnitte auf Bildschirmen).
20) Zu den gleichen Honoraransätzen wird von den Architekten mehr Leistung verlangt, als im vor-digitalen Zeitalter.
21) Zu standardisierte Architektur ausser bei intensivstem Einsatz individualisierter para-metrisierter Entwurfshilfsmittel.
Während bei den eigenen Angaben von Vorteilen (Frage 11) lediglich dreizehn stich-
wortartige Antworten eintrafen, wird hier bei den Nachteilen rege Gebrauch gemacht

Datenermittlung 69
——————————————————————————————————————————
von der Möglichkeit der eigenen Angabe. Ähnlich einem unter Druck stehenden Ventil
darf hier endlich der Dampf abgelassen werden. Diese starke Fokussierung auf die
Nachteile der Digitalisierung der Arbeit kann als ein weiterer Mosaikstein in der Bestä-
tigung der in der Arbeitshypothese formulierten Technologieabstinenz, bzw. einer ge-
wissen Angst vor neuen Technologien, betrachtet werden. Viele Architekten erachten
das Skizzieren und das Zeichnen von Papierplänen (1) als ein sinnliches und auch als
kommunikatives Erlebnis (19) bzw. als handwerkliche Tätigkeit (3) welches mit dem
Einsatz von CAD verloren geht. Schwierigkeiten sehen einige in der Genauigkeit (8)
und der Massstabslosigkeit (2), verglichen mit manuell erstellten Plänen. Es ist bezeich-
nend, dass die meisten Architekten unter CAD lediglich das Zeichnen von digitalen
Plänen am Computer und das Visualisieren (16) verstehen. Negative Nebenerscheinun-
gen wie die körperlich einseitige Belastung (11, 15) werden beklagt, ebenso das unkoor-
dinierte Arbeiten ohne Übersicht (7, 14, 17, 18). Ob die mangelnde Strukturierung und
Übersicht dem Einsatz von Computern zuzuschreiben ist, sei hier dahingestellt. Die hö-
here Wertschöpfung wird eher indirekt erkannt (5, 20), indem mehr Leistung erbracht
werden kann, aber auch muss. Tatsache ist, dass das Berufsbild des Hochbauzeichners
praktisch verschwunden ist (6), da praktisch alle Architekten nun auch zeichnen.
Als Zwischenbilanz kann festgehalten werden, dass viele Architekten die zunehmende
Digitalisierung der Arbeitswelt eher als notwendiges Übel denn als Chance betrachten.
Man versucht, mit der Zeit Schritt zu halten, indem man das CAD-Programm auf die
neueste Version aufrüstet, sieht sich aber immer noch als den das Gesamtwerk überbli-
ckenden Planer.
Skandinavien Schweden Schweiz Trend2000 2007 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Hoher und permanenter Aufwandfür Hard- und Software (Upgrading) 1 1 1
Gefahr der Informationsüberflutung 4 2 3
„Veränderungen sind unnötig, da bisanhin alles zufriedenstellend lief“ 5 3 9
Personal benötigt mehr Know-How 3 4 2
Zu hohe Investitions-, Schulungs- und Trainingskosten 2 5 5
Nichtkompatibilität der Software 6 6 6
Bestehende Prozesse und Ordnungenverhindern eine sinnvolle Digitalisierung 7 7 8

Datenermittlung 70
——————————————————————————————————————————
Verminderte Datensicherheit 8 8 7
Keine einheitlichen Standards(proprietäre Software) 9 9 4
Der hohe und permanente Aufwand, die Hard- und Software à jour zu halten, gilt in al-
len Ländern im internationalen Vergleich als Hauptnachteil. Spezifisch für die Schweiz
kommt hinzu, dass das Personal mehr Know-How benötigt. Der Vorwurf der uneinheit-
lichen Standardisierung (proprietäre Software) gilt nur bedingt und zeigt eher eine ge-
wisse Unkenntnis der aktuellen Tendenzen (Industry Foundation Classes (IFC) als offe-
ner Standard für Gebäudemodelle im Bauwesen)82. Die dritte Aussage mit dem leicht
provokativen Unterton ('Veränderungen sind unnötig, da bis anhin alles zufriedenstel-
lend lief') fand bei den Schweizer Architekten kein Gehör. Dies zeugt von einem gewis-
sen Verständnis für die Änderungen, welche auf die Branche zukommen werden.
4.2.7 Zukünftige Investitionen im IT-Bereich und deren Motivation
13. In welchen IT-Bereichen sehen Sie am ehesten Bedarf für (mögliche) Investitionen in den nächsten 1 bis 3 Jahren?
Stimme Stimme Eher Stimme Keine voll zu eher zu nicht zu nicht zu Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––CAD-Software für das Erstellen von 2D-Plänen 57 71 60 38 4
CAD-Software für das Erstellenvon digitalen 3D-Modellen 45 89 65 28 3
Informationsmanagement (Mgmt. vonModellen, Varianten und Versionen) 21 59 117 27 6
Projektspezifische Netzwerke (Plan-plattformen etc.) 32 90 82 24 2
Building Information Modeling 11 48 115 43 13
Informationssuche im Internet zurUnterstützung der täglichen Arbeit 49 92 64 23 2
Projektmanagement, Projektsteuerung 47 98 64 18 3
Kostenplanungs- und -kontrollsysteme 53 99 56 19 3
82 Siehe auch Kapitel 3.8 Building Information Modeling

Datenermittlung 71
——————————————————————————————————————————
Mobile Computersysteme 25 81 90 31 3
Virtual Reality 6 47 99 67 11
Andere Bereiche (eigene Eingabe):
1) 3D-Modellbaumaschinen (Laser oder Schneidplotter)
2) Die Investitionen nehmen Jahr für Jahr zu, leistungsfähige Programme ermöglichen vieles, z.B. Integration von Bilddaten; dies führt zu einer riesigen Datenproduktion und hat zur Folge, dass die Hardware nachkommen muss, Server / Stationen / Back-ups / Internetzugang inkl. Leitungen zu Plotter und Drucker.
3) Hardware aktualisieren, mehr Leistung.
4) Keine Investitionen, da die meisten Programme bereits im Einsatz sind und regelmäs-sig gewertet werden.
5) Will keine Verkäufer an den Hals bekommen.
Bei der Frage nach zukünftigen Investitionen zeigt sich ein nicht ganz so klares Bild
wie bei den vorhergehenden Fragen. Die Antworten sind deshalb mit Vorsicht zu genies-
sen und eher als Tendenzen zu verstehen. Bevorzugt werden tendenziell Investition in
die klassischen CAD-Systeme (2D und 3D), in Planplattformen und in Projekträume.
Eher weniger Bedarf sehen die meisten in Ausgaben für Informationsmanagement, Buil-
ding Information Modeling, Virtual Reality und mobile Systeme. Die Antworten zeigen
auf, dass die Schweizer Architekturbüros bezüglich ihren Investitionen pragmatisch ein-
gestellt sind und Anschaffungen mehr objekt- bzw. projektorientiert tätigen und nicht in
Systeme, deren Nutzen vielleicht nicht unmittelbar erkennbar ist, sondern eher strate-
gisch längerfristig angelegt ist. Ein wichtiges Investitionsfeld ist, wie für viele andere
Bereiche auch, das stetige Aktualisieren der im Einsatz stehenden Hard- und Software.
14. Welche externen Gründe würden Sie motivieren, die oben genannten Investitionen zu tätigen?
Stimme Stimme Eher Stimme Keine voll zu eher zu nicht zu nicht zu Angabe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Der Auftraggeber wünscht eine durch- gehende Gebäudemodellierung 31 92 77 27 3
Die Baubewilligung wird nur nochauf Grund von 3D-Modellen erteilt 21 60 89 56 4
Die Fachplaner arbeiten interaktiv am gleichen digitalen Modell 30 117 59 22 2

Datenermittlung 72
——————————————————————————————————————————
Alle CAD-Programme basieren auf ei-nem durchgängig kompatiblen Format 90 105 28 4 3
Das digitale 3D-Modell wird weiter-benutzt für Bewirtsch., Sanierung etc. 36 94 75 20 5
Vereinfachte Ableitung von gebäude-technischen Nachweisen (Minergie, ...) 56 117 42 12 3
Junge Mitarbeiter beherrschen dieneuen Techniken 51 132 36 7 4
Visualisierungen können jederzeitselber erstellt werden 54 112 52 8 4
Spezielle Interfaces ermöglichen einEntwerfen im digitalen Raum 18 71 109 25 7
3D-Modelle von gebauten Objektensind öffentlich zugänglich (OpenSource) 23 67 98 35 7
Andere Bereiche (eigene Eingabe):
1) 3D-Modelle werden heute noch sehr wenig eingesetzt: 3D-Modelle werden bei Pla-nern auf Grund mangelnder Konversionsmöglichkeiten der unterschiedlichen Soft-ware selten eingesetzt – Aufwand im 3D gegenüber 2D noch zu gross (z-B. Facility Management), deshalb haben Auftraggeber noch wenig Interesse. Öffentlich zugäng-liche 2D- oder 3D- Modelle kommen einer Aufhebung des Urheberrechtes gleich.
2) Auftrag für ein grosses Projekt > 30 Mio. (Neubau): Ein Mitarbeiter kann angestellt werden, der die notwendigen Techniken einwandfrei kennt.
3) Effiziente, präzise, schnelle Arbeitsweise im interdisziplinären, jedoch bürointernen Kontext; eigene Wertschöpfungsquote steigt.
4) Weitere erschwingliche Geräte für Modellbau ab Plan.
Ein bisschen klarer als bei den beabsichtigten Investitionen ist das Bild bei der zusätzli-
chen Motivation, welche die Büros dazu animieren könnte, in digitale Werkzeuge zu in-
vestieren. Obwohl schon grosse Anstrengungen unternommen wurden, ist für viele die
Frage der Kompatibilität noch nicht gelöst. Das durchgängig kompatible Datenformat
ist für sie ein Wunsch und Motivation für weitere Investitionen. Dass junge Hochschul-
abgänger die neuen Technologien beherrschen und daher für Büros attraktiv sind, ist
eine weitere Motivationsquelle. Ebenso die Möglichkeiten, die sich mit dreidimensiona-
len Gebäudemodellen öffnen, sind sie einmal erstellt, wie beispielsweise vereinfachte
gebäudetechnische Nachweise oder die Möglichkeit, selber Visualisierungen zu erstel-
len. Tendenziell sind interne Gründe oder Möglichkeiten, die sich dem Büro bieten, eher
eine Motivation für weitere Investitionen als externe Zwänge, wie beispielsweise dass
die Baubewilligung nur noch basierend auf digitalen Modellen erteilt wird. Hier zeigt

Datenermittlung 73
——————————————————————————————————————————
sich ebenfalls, dass viele Schweizer Architekturbüros tendenziell eher pragmatisch ori-
entiert sind.
4.3 Interviews mit ausgewählten Gesprächspartnern
4.3.1 Auswahl der Gesprächspartner
Beabsichtigt wurde ursprünglich, an dieser Stelle drei Interviews mit Vertretern aus ver-
schiedenen Architekturbüros zu führen, je einem Vertreter aus einem kleinen und gros-
sen Büro und einem aus einem technologisch 'innovativen' Büro. Es bot sich jedoch die
Gelegenheit, ein direktes Interview zu führen mit Dr. Ludger Hovestadt, Professor für
Architektur und CAAD an der ETH Zürich. Das Interesse seiner interdisziplinären For-
schung gilt der Entwicklung von Werkzeugen zum Entwurf und dem Management über-
komplexer Systeme. Die aktuellen Schwerpunkte sind 'Generative Design', 'Digital Pro-
duction' und 'Building Intelligence.83
Des Weiteren wurde ein Interview geführt mit Herrn Micha Bucher, IT-Verantwortlicher
im Architekturbüro Itten & Brechbühl, einem grossen Büro mit rund 190 Mitarbeitern
an vier Standorten.84 Da der Verfasser der vorliegenden Arbeit Erfahrung gesammelt hat
im eigenen Büro (vier Mitarbeiter) und derzeit in einem Büro mit rund acht Mitarbeitern
tätig ist, wird auf ein Interview mit einem Vertreter eines kleinen Büros verzichtet. De-
ren Ansichten, Sichtweisen und auch Ängste sind in vielfältiger Weise schon in diese
Arbeit eingeflossen.
4.3.2 Interview mit Ludger Hovestadt
Nur die wichtigsten Aussagen des Interviews werden hier wiedergegeben. Der genaue
Wortlaut ist im Anhang B ersichtlich.
Die Gebäudeautomation bildet einen aktuellen Forschungsschwerpunkt der Professur.
Einzelne Bauelemente, vor allem elektrische Geräte, beginnen untereinander als System
zu agieren. Stichworte hierfür sind 'Smart Building', Energiereduktion oder Erhöhung
von Komfort und Sicherheit. Bisher wurde (erfolgreich) versucht aus CAD-Modellen
Maschinen anzusteuern. Ein weiterer Schwerpunkt ist die intelligente Nutzung des In-
ternets im Planungsalltag. Kataloge von Leistungspositionen wie auch Ausschreibungen
sind online auf ein Web-2.0-System (selbstregulierend, ähnlich wie beispielsweise Wi-
kipedia) gestellt. So kann jeder Teilnehmer live dabei sein und auch von andern lernen.
Da dieses Tool erst im März 2009 aufgeschaltet wurde, liegen noch keine Erfahrungs-
83 Siehe auch: <http://www.caad.arch.ethz.ch/>; Abrufdatum: 02.08.2009, 14:30 Uhr.84 Siehe auch: <http://www.ittenbrechbuehl.ch>; Abrufdatum: 02.08.2009, 14:35 Uhr.

Datenermittlung 74
——————————————————————————————————————————
zahlen vor. Im Zusammenhang mit dem parametrisierten Entwerfen, dem Gebrach der
Entwurfsautomaten, ist noch zu erwähnen, dass damit nicht viel Wertschöpfung gene-
riert werden kann, da man den (schlecht bezahlten) Architekten aus seiner originären
Disziplin verdrängt. Lediglich für das Erstellen von Freiformflächen (analog den Bauten
von Frank O. Gehry) sind Entwurfsautomaten sinnvoll.
In der Forschung als abgehakt betrachtet werden können Themen wie 2D-CAD, 3D-
Modellieren, computergesteuerter Modellbau und Visualisierungen. Heute ist es ver-
mehrt das Ziel, durch intelligente Gebäudeautomation, die Mechanik (Lüftungsrohre,
zentrale Verteilsysteme etc.) aus dem Gebäude zu entfernen. Bauteile, die ein schlaues,
informationstechnisches System bilden, erlauben ein viel freieres und effizienteres Bau-
en, da die Infrastruktur weniger restriktiv wirkt. Die Automationstechnik wie auch die
Energieversorgung über immer billiger werdende Solarzellen werden vieles im Bauwe-
sen nachhaltig beeinflussen. Ähnlich wie vor Jahren das CAD, dann Multimedia, jetzt
die computergesteuerte Produktion und der Modellbau wird als nächstes die Automati-
onstechnik systematisch Einzug halten in die Arbeitswelt der Architekten.
Aus ökonomischer Sicht kann man sagen, je weiter man vom Entwurf weggeht, desto
mehr Wertschöpfung kann generiert werden. Im Entwurf ist die Wertschöpfung eher in
der Vernetzung zu suchen als in den Entwurfsautomaten. In Netzwerken organisierte
Planer sind erst dann leistungsfähig, wenn nicht starre Hierarchien zu Grunde liegen.
Das heisst: Bestimmte Themen und Lösungswege liegen da und derjenige der es schafft,
den nächsten Schritt zu machen, der macht ihn dann. Begriffe wie Entwurfskontrolle,
Verantwortung oder Urheberrecht im klassischen Sinne werden in Zukunft interessante
Forschungsthemen abgeben.
Diese Umbrüche, die dem Metier des Architekten bevorstehen, werden vermutlich nicht
radikal vonstatten gehen, eher schleichend, aber stetig und immer nachvollziehbar.
4.3.3 Interview mit Micha Bucher
Der Computer wird im Büro Itten+Brechbühl hauptsächlich für das Erstellen von vekto-
riellen, zweidimensionalen Plänen benutzt. Oft werden auch Grundrisse mit dreidimen-
sionalen Objekten wie Wänden, Türen etc. gezeichnet, jedoch werden diese dann nur
zweidimensional weiterverwendet (sog. 'zweieinhalb-D'). So erstellte Modelle können
dann schnell und effizient für die Erstellung von geometrischen dreidimensionalen ver-
wendet werden, falls notwendig. Nur wenn der Kunde es ausdrücklich wünscht, werden
Visualisierungen der Projekte erstellt. Bei I+B arbeitet ein Kernteam aus vier Mitarbei-
tern im Bereich 3D-Visualisierungen. Verwendet wird dabei das gängige Programm Au-
toCAD® für das Modellieren und die Visualisierungssoftware Cinema4D® in der Phase

Datenermittlung 75
——————————————————————————————————————————
des Renderings. Die Modelle werden nach der Visualisierung nicht mehr weiterverwen-
det. Parametrische Entwurfshilfen werden bei I+B (derzeit) noch nicht eingesetzt. Ab
und zu werden Volumenmodelle zur Herstellung von physischen Modellen eingesetzt
(Rapid Prototyping). Dies geschieht jedoch nicht mehr intern. Aus Kostengründen wer-
den die automatisierten Modelle von diesbezüglich ausgerüsteten Modellbauern erstellt.
Bei Projekten, welche speziell geformte Betonfertigteile beinhalten, kommen Techniken
zum Einsatz wie das CNC-gesteuerte Fräsen von Betonschalungen aus Styroporblö-
cken85. Modelliert werden in der Planung dann nur die zu erstellenden Teile, die der aus-
gewählte Unternehmer dann mit Hilfe der Fräse herstellt. Eine durchgehende Digitali-
sierung mittels 'Building Information Modeling' wurde bei I+B (bis heute) noch nicht
durchgeführt.
Generell kann gesagt werden, dass das Erstellen von zweidimensionalen Plänen, teils
mit Hilfe von dreidimensionalen Elementen relativ schnell geht. Sehr viel mehr Zeit be-
nötigen die Änderungen der Pläne. Man kann sagen, dass der Architekt heutzutage die
meiste Zeit damit verbringt, Pläne zu ändern.
85 Siehe auch Kapitel 3.7.3, S. 39.

Schlussfolgerungen 76
——————————————————————————————————————————
5 Schlussfolgerungen
5.1 Erkenntnisse aus der Datenermittlung
Im Kapitel 3.12 wurden folgende fünf Stufen definiert, anhand derer sich die in der On-
line-Umfrage befragten Architekturbüros einordnen lassen:
1. Zeichnen von zweidimensionalen, vektoriellen Plänen
2. Aufbau von dreidimensionalen, geometrischen Modellen
3. Einsatz von Parametrisierung als Entwurfsmittel
4. 3D-Gebäudemodelle zur Bauteilproduktion bzw. zum Modellbau
5. Durchgehende Digitalisierung mittels 'Building Information Modeling'
5.1.1 Zeichnen von zweidimensionalen, vektoriellen Plänen
Das Zeichen von zweidimensionalen, vektoriellen Plänen ist in Schweizer Architektur-
büros die Haupttätigkeit, für welche Computer eingesetzt werden. Folgende Grafik ver-
deutlicht diese Aussage. Sie gilt praktisch identisch für kleine (bis 4 Mitarbeiter), mittle-
re (5-19 Mitarbeiter) wie auch für grosse Büros (über 20 Mitarbeiter)86. Die insgesamt
230 an der Umfrage beteiligten Büros gliedern sich auf in 89 kleine, 111 mittlere und 30
grosse Büros. Zu beachten ist die statistische Unschärfe, die dieser relativ geringen An-
zahl Antworten zu Grunde liegt, verglichen mit den insgesamt ca. 9'500 in der Schweiz
tätigen Architekturbüros.
Abbildung 24: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer zum Zeichnen von zweidi-mensionalen, vektoriellen Plänen benutzen, nach Bürogrösse gegliedert
86 Die in Kapitel 4.2.2 (Abbildung 23) benutzte Unterscheidung der Bürogrössen in sechs Kategorien wurde hier zwecks Leserlichkeit auf drei reduziert.

Schlussfolgerungen 77
——————————————————————————————————————————
5.1.2 Aufbau von dreidimensionalen, geometrischen Modellen
Dreidimensionale Gebäudemodelle werden von einer Mehrheit schon eingesetzt, sei es
zur Kontrolle des eigenen Entwurfs, sei es für Visualisierungen. Interessant ist hier die
Aufteilung auf die unterschiedlichen Bürogrössen. Vorwiegend kleine Büros setzen die-
ses Planungswerkzeug nicht ein. Mittelgrosse Büros haben tendenziell schon eher Er-
fahrung damit, während für fast die Hälfte der grösseren Büros das geometrische Ge-
bäudemodell ein schon öfters angewandtes Hilfsmittel darstellt. Grössere Büros sind
hier sozusagen fortschrittlicher bezüglich ihres Detaillierungsgrades als kleinere Büros.
Zu beachten ist hier die tiefe Quote der leeren Antworten wie übrigens auch im vorher-
gehenden Kapitel.
Abbildung 25: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer zur Erstellung von dreidi-mensionalen, geometrischen Gebäudemodellen benutzen, nach Bürogrösse gegliedert
5.1.3 Einsatz von Parametrisierung als Entwurfsmittel
Wie zu erwarten war, zeigt sich bei der Frage nach der Parametrisierung als Entwurfs-
hilfsmittel ein unscharfes Bild. Neben den relativ gleichmässig verteilten Antworten er-
staunt hier die hohe Zahl derjenigen, die keine Angaben machten87. Lediglich eine Ten-
denz ist auszumachen: Grössere Büros setzen das Mittel der Parametrisierung eher ein
als kleinere Büros.
87 Siehe auch die in Kapitel 4.2.2 aufgeführten Gründe

Schlussfolgerungen 78
——————————————————————————————————————————
Abbildung 26: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer einsetzen zur Parametrisie-rung des Entwurfes, nach Bürogrösse gegliedert
5.1.4 3D-Gebäudemodelle zur Bauteilproduktion bzw. Modellbau
Die weiterführende Verwendung der Gebäudemodelle zur Herstellung von Bauteilen
oder zum Modellbau ist noch sehr wenig verbreitet. Lediglich eine Minderheit hat schon
Erfahrung gesammelt damit. Ebenfalls wie in den vorhergehenden Kapiteln zeigt sich
auch hier, dass grössere Büros dank der Möglichkeit der Spezialisierung der Mitarbeiter
neueren Technologien eher zugeneigt sind als kleinere Büros.
Abbildung 27: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer zur Herstellung von Bautei-len oder zum Modellbau benutzen, nach Bürogrösse gegliedert

Schlussfolgerungen 79
——————————————————————————————————————————
5.1.5 Durchgehende Digitalisierung mittels BIM
Am wenigsten verbreitet ist erwartungsgemäss der fünfte Punkt, die durchgehende
Digitalisierung der Projekte mittels 'Building Information Modeling'. Lediglich die
Gruppe der grösseren Büros zeigt eine Tendenz auf, diese Technologie schon einmal
eingesetzt zu haben.
Abbildung 28: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros, die den Computer für die durchgehende Digi-talisierung (BIM) ihrer Projekte benutzen, nach Bürogrösse gegliedert
5.1.6 Aussagen zur statistischen Signifikanz
In Kapitel 4.1.1 wurde bei einer Grundgesamtheit von 9'578 Büros, einem Konfidenzin-
tervall von 95% und einer Fehlerquote von 5% eine minimale Stichprobengrösse von
370 Teilnehmern ermittelt. Da jedoch lediglich 230 Büros an der Umfrage teilnahmen,
erhöht sich durch die geringere Stichprobengrösse die Fehlerquote von 5% auf 6.4%88.
Die ebenfalls im Kapitel 4.1.1 getroffene Annahme 1, welche besagt, dass die befragten
Büros (SIA-Firmenmitglieder) eine repräsentative Auswahl der in der Schweiz tätigen
Architekturbüros darstellen, muss mit Vorsicht genossen werden. Wie in Kapitel 4.2.1
erläutert, stimmt die Verteilung der Bürogrössen nicht mit den vom SIA und vom BfS
ermittelten Daten überein.
Die statistisch bedingte höhere Fehlerquote und noch wichtiger, die nicht sehr verlässli-
che Annahme 189, lassen die ermittelten Daten in einem andern Licht erscheinen. Die
88 <http://www.raosoft.com/samplesize.html>; Abrufdatum: 31.07.2009, 13.30 Uhr89 Siehe auch: Kapitel 4.1.1, S. 50.

Schlussfolgerungen 80
——————————————————————————————————————————
mit der Umfrage eruierten Daten und die daraus gewonnene Erkenntnis sind somit eher
als Tendenzen zu verstehen denn als präzise mathematische Resultate. Wichtiger als die
Nachkommastelle bei den prozentualen Verteilungen sind beispielsweise die relative
Aufteilung der Antworten auf die unterschiedlichen Bürogrössen oder die relativen Ver-
änderungen innerhalb des Fragenkatalogs.
5.2 Vergleich im internationalen Rahmen
Wie in Kapitel 1.5 erwähnt, sollen an dieser Stelle die ermittelten Ergebnisse denjenigen
in Skandinavien aus den Jahren 1998, 2000 und 2007 gegenübergestellt werden. Die
1998 durchgeführte Untersuchung90 brachte unter anderem Folgendes zu Tage: Rund
60% der untersuchten Firmen hatten eine Verbindung zum Internet, ca. 30% (Finnland)
bis 60% (Schweden) eine eigene Homepage (CH 2009: 71%)91. Zwischen 20% (Aus-
schreibungsunterlagen) und 40% (Pläne und Protokolle) der Dokumente wurden 1998
in den genannten Ländern digital übermittelt. Rund die Hälfte der CAD-Anwender
zeichnete strukturierte (Objekte auf verschiedenen Layers) wie auch unstrukturierte,
zweidimensionale Pläne. Referenzierte Files (Databases) wie insbesondere auch dreidi-
mensionaler Objekte wurden erst von einer Minderheit eingesetzt. Der Nutzen zuneh-
mender IT-Unterstützung in Form höherer Produktivität wurde erkannt, insbesondere im
Entwurf (CAD) und in der Administration. Als einer der zukünftigen Forschungs-
schwerpunkte wurde die Etablierung einheitlicher Datenstandards genannt, dies obwohl
Bestrebungen in diesem Sinne schon damals im Gange waren. Zudem wurde festge-
stellt, dass mit der zunehmenden Benutzung des Internets auch die Datenerhebungen
mittels Umfragen zunahmen, was sich in einer abnehmenden Rücklaufquote bemerkbar
machte.
Zwei Jahre später führte Olle Samuelson in seinem 'IT-Barometer 2000 – The Use of IT
in the Nordic Construction Industry'92 die Untersuchung in leicht abgewandelter Form
erneut durch. Dabei wurde festgestellt, dass die Bedeutung und der Einsatz von Compu-
tern, der Zugang zum Internet sowie die vermehrte mobile Kommunikation innert der
betrachteten zwei Jahre zunahmen. Der Gebrauch von Computern beschränkt sich aller-
dings immer noch auf Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Buchhaltung- und Admi-
nistration. Noch nicht in grösserem Masse durchgesetzt haben sich Technologien wie
projektbezogene Netzwerke, elektronischer Handel, 'Product Models' und Anwendun-
gen der 'Virtual Reality'. Im Gegensatz zu Schweden verzeichnen Dänemark und Finn-
land einen zunehmenden Einsatz von modellbasierten CAD-Anwendungen. Eine besse-
90 Vgl. Howard et al. (1998)91 Siehe auch Kapitel 4.2.2, S. 5892 Vgl. Samuelson (2002)

Schlussfolgerungen 81
——————————————————————————————————————————
re finanzielle Kontrolle sowie schnellerer Zugang zu Informationen wurden als Haupt-
gründe für einen vermehrten IT-Einsatz angegeben. Die befragten Büros gaben an, dass
die Investitionskosten wie auch die Kosten für das 'Upgrading' die grössten Hindernisse
darstellten.
Die im Jahre 2007 durchgeführte Untersuchung 'The IT-Barometer – A Decade's Deve-
lopment of IT use in the Swedish Construction Sector'93 brachte folgende Erkenntnis zu
Tage: Der Gebrauch des Computers hat sich in der Planungsbranche praktisch überall
durchgesetzt, auf der Baustelle ist der Einsatz immer noch steigend. Unter den Architek-
ten wird CAD-Software nicht mehr nur in geometrischem Sinne als Zeichenhilfe be-
nutzt, vermehrt werden Modelle mittels objektbasierter Datenbanken generiert. Eben-
falls zugenommen hat unter den Architekten der Einsatz von projektbezogenen Netz-
werken. Folgende Grafik verdeutlicht den architektenspezifischen Einsatz von digitalen
Arbeitsmitteln in Skandinavien im Jahre 2007. Zu beachten ist, dass die einzelnen
Punkte kumulierend aufgelistet sind, d.h. rund 2 Prozent benutzen kein CAD, ca. 12
Prozent benutzen CAD im zweidimensionalen Sinne, ca. 60 Prozent zwei- und dreidi-
mensional, etc..
Abbildung 29: Aufteilung des CAD-Einsatzes in Skandinavien (2007)
Im Vergleich mit den in dieser Arbeit ermittelten Zahlen fällt auf, dass in Skandinavien
wie auch in der Schweiz nur noch ganz wenige Büros (< 3 Prozent kein CAD einsetzen.
Ähnlich hoch ist mit 60 Prozent der Anteil derjenigen, die CAD zwei- und dreidimen-
sional einsetzen (CH 2009: 12 Prozent: noch nie / 28 Prozent: mind. schon einmal / 35
Prozent: meistens / 5 Prozent: immer). Signifikant höher als in der Schweiz ist in Skan-
dinavien die Zahl derer, die CAD nicht nur im geometrischen Sinne, sondern auch als
objektbasierte Datenbanken einsetzen. Rund 18 Prozent der skandinavischen Architek-
turbüros setzen objektbasierte Datenbanken ein, was auf eine weiterreichende Digitali-
sierung im Sinne von 'Building Information Modeling' schliessen lässt. Die Schweiz
93 Vgl. Samuelson (2008)

Schlussfolgerungen 82
——————————————————————————————————————————
liegt hier mit einer Quote von rund 12 Prozent (9 Prozent: mind. schon einmal / 2 Pro-
zent: meistens / 1 Prozent: immer) deutlich dahinter.
5.3 Arbeitshypothesen
Hypothese 1: Schweizer Architekturbüros benutzen das Arbeitsmittel des Computers le-
diglich als digitales Zeichenbrett für die Erstellung von zweidimensionalen Vektorplä-
nen und ignorieren dabei die potentiellen Möglichkeiten, wie man die Rechner sonst
noch einsetzen könnte.
Auf Grund der gesammelten Erkenntnis kann die erste Hypothese tendenziell bejaht
werden, wenn das Wort 'lediglich' durch das Wort 'vorwiegend' ersetzt wird. Über den
2D-Plan hinausgehende Anwendungen wurden in vielen Büros zumindest schon einmal
getestet.
Hypothese 2: Dreidimensionale Gebäudemodelle sind zwar bekannt, werden aber nicht
in grossem Umfang eingesetzt, da sie letztlich in der konventionellen Bauplanung nicht
direkt umgesetzt werden können.
Die zweite Hypothese muss eher verneint werden. Nur rund 12% der befragten Büros
haben noch nie dreidimensionale Gebäudemodelle in irgendeiner Form eingesetzt94,
28% mindestens schon einmal, 35% meistens und 20% immer. Somit kann nicht gesagt
werden, dass diese Arbeitsweise 'nicht in grossem Umfang eingesetzt' wird.
Hypothese 3: Die durchgehende digitale Planung mittels 'Building Information Mode-
ling' (BIM) oder 4D-Design ist in den Schweizer Architekturbüros praktisch unbekannt
und nicht verbreitet.
Gestützt auf die ermittelten Daten kann die dritte Hypothese eindeutig bejaht werden.
Die durchgehende digitale Planung ist in der Schweiz nicht verbreitet. Lediglich
grössere Büros zeigen eine leichte Tendenz, Projekte schon einmal durchgehend
digitalisiert geplant zu haben.
94 Siehe Abbildung 30, S. 85

Schlussfolgerungen 83
——————————————————————————————————————————
5.4 Ausblick für das Metier des Architekten
Die Branche der Schweizer Architekturbüros ist geprägt durch kleinere und mittelgrosse
Büros, welche Prozesse und Technologien anwenden, die schon in ähnlicher Weise vor
der flächendeckenden Einführung des Computers Bestand hatten. Die stetig wachsende
Leistungsfähigkeit der Rechner wie auch aus andern Branchen übernommene Prozesse
werden in Zukunft die Arbeitsweise strukturell beeinflussen. Der architektonische Ent-
wurf, eine der Haupttätigkeiten der Büros, wird allmählich seinen ökonomischen Wert
ein Stück weit verlieren. Ein integraler Entwurf eines Gebäudes, eine 'intelligente Simu-
lation von Architektur', welche sämtliche relevanten Informationen beinhaltet, bietet
dem Auftraggeber eine höhere Wertschöpfung als eine reine geometrische Projektion
des Geplanten. Dies bedingt eine vermehrte interdisziplinäre und interaktive Zusam-
menarbeit sämtlicher Planer, bedeutet aber auch, dass grössere Büros oder zu General-
planerteams zusammengeschlossene Büros bessere Chancen haben, diese Nachfrage zu
decken. Ein vertieftes Wissen über Fertigungs- und Automationstechniken wird wäh-
rend der Ausführung an Wichtigkeit zunehmen.
Das klassische Bild des alles überblickenden, gesamtleitenden Architekten, welcher
vom Städtebau bis zum Türgriff den Entwurf bestimmt, wird höchstens in einer Art Au-
torenarchitektur Bestand haben. Die Mehrzahl der Architekten wird sich zunehmend mit
einer Spezialisierung des Berufsbildes konfrontiert sehen, die einher geht mit dem ver-
mehrten Einsatz digitaler Hilfsmittel in der Planung. Ähnlich wie das allmähliche Ver-
schwinden des Hochbauzeichners mit der Einführung des Zeichnens mit CAD werden
die Veränderungen eher langsam oder evolutionär vonstatten gehen und nicht durch
grosse Brüche gekennzeichnet sein. Frisch ausgebildete, aber auch technisch interessier-
te Mitarbeiter werden genauso innovationstreibend wirken wie die Konkurrenz der an-
dern Büros.

Zusammenfassung 84
——————————————————————————————————————————
6 Zusammenfassung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Grad der Digitalisierung der Schweizer Archi-
tekturbüros anhand einer empirischen Untersuchung zu ermitteln. Hauptbeweggründe
dazu sind unter anderem die, verglichen mit andern Branchen, tiefe Arbeitsproduktivität
wie auch die relativ tiefe Marktattraktivität und Wettbewerbspositionierung der Pla-
nungsbrache. Während in Branchen wie dem Automobilbau, dank des Einsatzes neuer
Prozesse und Technologien die Wertschöpfung und die Produktivität stetig erhöht wur-
den, sind diese im Bereich des Planens und Bauens von Gebäuden erst ansatzweise vor-
handen. Im immobilienwirtschaftlichen Prozess bewegt sich die Planung von Gebäuden
zwischen der reinen Dienstleistungsfunktion am Bauherrn und der gesellschaftlichen
Aufgabe eines kulturellen und nachhaltigen Beitrags an kommende Generationen. Mit
dem Einzug des Computers in die Büros wurden dem Architekten neue Werkzeuge in
die Hand gegeben, mit welchen sich die Effizienz der eigenen Arbeit massgeblich stei-
gern lässt. Nebst den bekannten Methoden des zweidimensionalen Planzeichnens und
neben dem geometrischen, dreidimensionalen Gebäudemodell sind dies beispielsweise
die Parametrisierung als Entwurfshilfe oder der Einsatz von 'Rapid Prototyping'. Das
automatisierte Herstellen von Modellen ist heute ebenso möglich wie das Erstellen gan-
zer Bauteile. Die durchgehend digitalisierte Planung im Sinne einer 'intelligenten Simu-
lation von Architektur'95 wird in der vorliegenden Arbeit als 'maximaler Grad' der Digi-
talisierung definiert. Die Gebäudemodelle beinhalten über die reine Geometrie hinaus
sämtliche relevanten Informationen über das Projekt und dessen Erstellung.
Die Online-Umfrage, an welcher sich 230 Büros beteiligten, brachte unter anderem fol-
gende Erkenntnis zu Tage: Die Büros beschäftigen durchschnittlich 9 Mitarbeiter. Zu
den am häufigsten genannten Kernkompetenzen zählen Entwurf und Ausführungspla-
nung, gefolgt von Bauleitung, Kostenplanung und Beratung. Mit durchschnittlich 1.11
Computern und 0.92 E-Mail-Adressen pro Mitarbeiter ist eine grundlegende Bedingung
für den Einsatz digitaler Werkzeuge und einer effizienten Zusammenarbeit zwischen
den Planern gegeben. Tendenziell verfügen kleine Büros über mehr Rechner als Grosse,
letztere jedoch über eine höhere Quote an E-Mail-Adressen.
Hinsichtlich der Verwendung allgemeiner Bürosoftware unterscheiden sich Schweizer
Architekturbüros nicht von andern Dienstleistungsbetrieben. Im Schnitt werden pro
Büro ein bis zwei CAD-Programme eingesetzt. Diese werden hauptsächlich für das
Zeichnen von zweidimensionalen Plänen eingesetzt. Weniger verbreitet, eher ab und zu
benutzt, werden dreidimensionale, geometrische Gebäudemodelle, sei es zur Kontrolle
des Entwurfs oder für Visualisierungen. Noch selten verwendet wird das von der Geo-
95 Vgl. Eastman (2008), S. 13

Zusammenfassung 85
——————————————————————————————————————————
metrie losgelöste Steuern des Entwurfes mittels Parametrisierung (eine gewisse Unklar-
heit bezüglich der Begrifflichkeit war festzustellen, was sich in einer höheren Quote lee-
rer Antworten bemerkbar machte). Noch weniger verbreitet ist die weiterführende Ver-
wendung der Daten zur automatisierten Herstellung von Modellen bzw. ganzen Bautei-
len. Praktisch noch unbekannt ist in der Schweiz die durchgehende Digitalisierung der
Projekte mittels 'Building Information Modeling'. Generell lässt sich feststellen, dass
grössere Büros eher dazu geneigt sind, neue Technologien einzusetzen als Kleinere. Fol-
gende Grafik verdeutlicht die fünf oben genannten Anwendungen.
Abbildung 30: Aufteilung der Schweizer Architekturbüros nach ihrem Digitalisierungsgrad
Die Zusammenarbeit mit andern Planern oder Unternehmern verläuft am häufigsten
über den Datenaustausch via E-Mail. Das interdisziplinäre Arbeiten am gleichen Gebäu-
demodelle wird erst von einer kleinen Minderheit praktiziert.
Bei der Frage nach den Vorteilen, welche die zunehmende Digitalisierung der Arbeits-
welt den Architekten bietet, liegen die pragmatischen, direkt im Alltag umsetzbaren
Punkte vor den eher strategisch angelegten Vorteilen. Dies sind insbesondere Themen
wie der einfache und schnelle Zugriff auf gemeinsame Informationen, die einfachere
Handhabung grösserer Datenmengen oder das schnellere Arbeiten. Als grösste Nachteile
werden angesehen: der hohe und permanente Aufwand für das 'Upgrading' der Hard-
und Software, das zusätzlich benötigte Know-How des Personals sowie die allgemeine
Gefahr der Informationsüberflutung. Aus der Verteilung der Voten und der eigens einge-
gebenen Punkte ist zu schliessen, dass ein Grossteil der an der Umfrage beteiligten Bü-
ros die vermehrte Digitalisierung eher als 'Muss' empfindet denn als Chance betrachtet.

Zusammenfassung 86
——————————————————————————————————————————
Schwierigkeiten sehen einige in der Genauigkeit und der Massstabslosigkeit im Arbei-
ten mit CAD, ebenso in Nebenerscheinungen wie der einseitigen körperlichen Belas-
tung. Dafür gehen Fähigkeiten wie das Zeichnen von Hand oder die Diskussion am phy-
sischen Modell ein Stück weit verloren.
Investitionsbedarf sehen die meisten neben dem permanenten 'Upgrading' der Hard- und
Software vorwiegend in klassischen 2D- und 3D-CAD-Systemen. Tendenziell sind in-
terne Gründe oder Möglichkeiten, die sich dem Büro bieten, eher eine Motivation für
weitere Investitionen als externe Zwänge, was die pragmatische Orientierung vieler Bü-
ros unterstreicht.

Anhang IX
——————————————————————————————————————————
Anhang
A Wortlaut des Einladungsmails für die Online-Umfrage
Sehr geehrte Berufskolleginnen und -kollegen
Als Architekt und Student am 'Center for Urban & Real Estate Management' (CUREM) befasse ich mich im Rahmen meiner Masterthesis mit den Herausfor-derungen und Chancen, welche der vermehrte Einsatz des Computers unserem Metier bietet. Mein Ziel ist es, herauszufinden, inwieweit die Architekturbüros von den diversen digitalen Werkzeugen und Methoden Gebrauch machen, mit andern Worten, den 'Grad der Digitalisierung' der Schweizer Architekturbüros zu ermitteln.
Ein Teil der Analyse besteht aus einer Online-Datenerhebung mit insgesamt 14 Fragen. Da eine repräsentative Aussage nur mit einer genügend grossen Anzahl Rück-meldungen möglich ist, benötige ich unbedingt Ihre wertvolle Unterstützung und bitte Sie, die 14 Fragen im folgenden Link möglichst wahrheitsgetreu zu beantworten. Das Beantworten der Fragen dauert ca. 5 Minuten. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
http://www.i4ds.ch/de/survey/digitalisierungsgrad.html
Nach der Beantwortung der Fragen können Sie optional Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ich werde Ihnen nach Abschluss der Masterthesis die daraus gewonnene Erkenntnis in Form eines 'Management Summary' zustellen (ca. September 2009).
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!Freundliche Grüsse,
Reto Kunzdipl. Arch. ETH / cand. MSc Real Estate Management
Für Fragen und Auskünfte zu meiner Masterthesis stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.E-Mail: [email protected]
weiterführende Links:www.curem.ch Center for Urban & Real Estate Managementwww.fhnw.ch/technik Fachhochschule Nordwestschweiz – Hochschule für Technikwww.i4ds.ch Institut für 4D-Technologienwww.sia.ch Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Anhang X
——————————————————————————————————————————
B Wortlaut des Interviews mit Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Sehen Sie neben den Bereichen 2D-Planzeichnen, parametrisiertes Entwerfen, 3D-Mo-
dellierung zur Entwurfskontrolle, zur Erstellung von Visualisierungen, zur Herstellung
von physischen Modellen, zur Herstellung von Bauteilen und dem Einsatz von 'Building
Information Modeling' weitere Bereiche, in denen Architekten digitale Hilfsmittel ein-
setzen können?
„(...) Als Forscher suche ich mit meinem Team nach prinzipiellen Möglichkeiten, was
man mit digitalen Hilfsmitteln in der Architektur alles tun kann. Ein wesentliches Feld,
das Sie nicht aufgezählt haben, ist die Gebäudeautomation. Einzelne Bauelemente, vor
allem elektrische Geräte, beginnen untereinander als System zu agieren. Stichworte
hierfür sind Smart Building, Energiereduktion oder Erhöhung von Komfort und Sicher-
heit. Das Ziel ist die Erhöhung der Energieeffizienz, des Komforts und der Sicherheit
während des Betriebes der Gebäude. (...) Bisher war unsere Arbeit geprägt durch Pro-
jekte, welche versuchten, aus CAD-Modellen Maschinen anzusteuern, und so neue For-
men der Baukonstruktion zu finden, was Gramazio & Kohler1 ja erfolgreich in die Ar-
chitektenschaft hinein propagieren. Da haben wir enorm viele Experimente gemacht
und machen das auch weiter. Das war auch einer der wesentlichen Punkte meiner bis-
herigen Zeit hier an der ETH. Automation ist vermutlich etwas, was erst wichtig wird,
das braucht aber noch seine Zeit, weil es in seiner Art noch zu weit weg ist von dem,
was Architekten attraktiv finden. Das ist jedoch ökonomisch enorm interessant, hier
funktionieren auch unsere Spin-Offs viel besser als in andern Bereichen. (...)
Ein weiterer Punkt, den Sie nicht nannten, ist der Weg, wie das Internet in den Pla -
nungsalltag reinkommt. Neben der Gebäudeautomation ist der nächste wesentliche
Output unserer Professur die Arbeit, welche wir in Zusammenarbeit mit der CRB
(Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung) machen2. Die bisherigen Kata-
loge von Leistungspositionen haben wir auf ein Web-2.0 System online gestellt, mit dem
Effekt, dass jeder Architekt mit seinen Ausschreibungen live online ist und auch von an-
dern lernen kann. Es werden keine Klassifikationen mehr vorgegeben, sondern ähnlich
wie in Wikipedia werden diese nur noch moderiert, jeder kann sie verändern. Man
weiss beispielsweise, wenn jemand eine Sichtbetonfassade erstellt hat, so hat er dieses
oder jenes Konstruktionssystem benutzt. Oder man sieht, dass ein Fenster für ein ähnli-
ches Projekt letzte Woche für diesen Preis vergeben wurde. Damit kann man viel von-
einander lernen.
1 Prof. Fabio Gramazio und Prof. Matthias Kohler, Assistenzprofessoren für Architektur und digitale Fabrikation am Departement Architektur der ETH Zürich.
2 Siehe auch: <http://www.crb.ch/go/crbinternet/3641/de/DesktopDefault.aspx/>, Abrufdatum: 21. Juni 2009, 16.40 Uhr.

Anhang XI
——————————————————————————————————————————
Wird dieses Werkzeug schon in grösserem Stil eingesetzt?
Eingepackt in herkömmlichen Software-Systemen kann es von Architekten, Fachplanern
und Bauunternehmungen eingesetzt werden. Dieses notwendigerweise kommende Werk-
zeug ist Teil einer sehr bedeutenden Infrastruktur, welche wir für den gesamtschweizeri-
schen Gebrauch aufgesetzt haben. Da rund 80% dessen, was in der Schweiz ausge-
schrieben wird, so gemacht wird, ist das ein sehr leistungsfähiger Schritt. Im Moment
jedoch fühlt sich noch alles an wie bisher, um niemanden zu erschrecken. Was darauf
aufbaut, sind die Elemente, die es ermöglichen, dass es nicht nur für die Ausschreibung,
sondern auch begleitend funktioniert. Das heisst, man kann jetzt Konstruktionen von
Kollegen übernehmen oder man kann Kostenschätzungen machen. Es wird sich weisen,
wie dies aufgenommen wird, aber technisch ist es da. Ich denke, es wird sich zeigen,
dass derjenige, der sich öffnet, sein 'Know-How' gegen Entgelt preisgibt und konstruk-
tiv damit umgeht, einfach schneller, besser, preiswerter etc. ist als andere. Aufgeschaltet
ist das Tool seit Ende Mai. Erfahrungszahlen gibt es noch keine, aber nach ein bis zwei
Jahren sollte es solide dastehen. (...)
All die Verfahren, die wir ja sehr prominent machen mit den Entwurfsautomaten oder
entwurfsunterstützenden Systemen, mit denen man dann präziser, detaillierter usw. pla-
nen kann, die sind alle brotlos. Wir kriegen es nicht hin, ausreichend Wertschöpfung
hinzubekommen. Man kann viel machen, es ist jedoch sehr kompliziert. Zudem ver-
drängt man Architekten aus ihrer originären Disziplin, welche ohnehin schon wenig
Geld bringt. Dies rechnet sich nicht.(...) Parametrisierte Entwürfe sind nötig, damit
man Freiform-Fassaden hinkriegt. Dafür muss man die Bauteile parametrisieren. Para-
metrisiert heisst, man deformiert einzelne Elemente nach bestimmten Regeln. Geht man
noch einen Schritt weiter und stellt noch die Auswahl der Elemente in einen Automaten,
da hätte man eigentliche Entwurfsautomaten, die Gebäude würden zu wachsen begin-
nen, und so weiter. Das ist dann aber richtig kompliziert. Dafür gibt es auch noch keine
Software. Man kann sehr viel machen, man kann tatsächlich auch deutlich differen-
zierter planen und die Performance von solchen Gebäuden nach vorgegebenen Kriteri-
en erheblich steigern, aber es gibt keine Anzeichen, dass damit ausreichend Wertschöp-
fung erzielt werden könnte. Anders als bei der digitalen Produktion, anders als bei der
Automationstechnik, anders als bei den neuen Internet-Plattformen ist im Bereich der
computerunterstützten Entwürfe wenig Wertschöpfung vorhanden. (...)
Themen wie 2D-CAD, 3D-Modellieren, computergesteuerter Modellbau, Visualisierun-
gen sind alle durch, das ist alles gegessen. (...) Was jetzt vermehrt kommt, ist das Her-
ausbringen von Mechanik aus dem Haus. Ziel ist es, die dicken Leitungssysteme aus
dem Gebäude zu bringen, indem vermehrt und unter vielen Aspekten die Informations-
technologie im Gebäude konstituierend wirkt. Vor allem in der Gebäudeautomation,
wenn alle Bauteile einigermassen schlau ein informationstechnisches System bilden,
dann kann ich Mechanik aus dem Gebäude raus schmeissen. Dicke Sprinklerrohre, Lüf-

Anhang XII
——————————————————————————————————————————
tungsrohre, Abluftsysteme, Heizungsrohre etc. braucht es dann nicht mehr. Der Effekt
ist, dass Gebäude viel weniger restriktive Infrastruktur benötigen, das heisst, man kann
viel freier anfangen zu bauen. Übrig bleiben kleine Apparate, welche mit Strom und Da-
ten versorgt werden; alles andere ist Software. Bisher musste man dicke Rohre verle-
gen, das wird einen grossen Schub auslösen. Es werden nun die ersten Häuser so ge-
baut, und da fängt dann die Informationstechnik wirklich an, strukturell und in den Aus-
drucksmöglichkeiten deutlich Effekte zu zeigen, so wie sie jetzt in der Geometrie in den
Freiformflächen wirkt. Die Luft wird beispielsweise nicht zentral gesammelt und in di-
cken Rohren verteilt, sondern dezentral über die Fassade reingeholt. Der Effekt davon
sind deutlich niedrigere Geschosshöhen als bisher. Die Gebäude werden preiswerter,
anpassungsfähiger und effizienter. (...)
Die Automationstechnik wird viel auf den Kopf stellen. Die Energieversorgung wird
über Wärmepumpen und über Strom mit Solarzellen funktionieren. Solarzellen werden
in Halbleiter-Drucktechnik erstellt. Diese sind beliebig reproduzierbar und haben einen
Preiszerfall von ca. 30% pro Jahr, ähnlich wie Computer, DVD oder Speicherkarten.
Eine heutige Zelle, die 25 Jahre lang Strom liefert, kostet so viel wie 3 Jahre ihres
Stroms. Es ist damit zu rechnen, dass man mit Solarzellen 1 kWh Energie erzeugen
kann, die nur 15 US-Cent kostet. Ein Beispiel: Ein Solarzelle mit einer Fläche die heute
in der Schweiz 1 kW Energie liefert, kostet im Moment 50 US-Cent, die leistet 25 Jahre
lang jedes Jahr 1 kW. Heute kostet dies 20 US-Cent. Das heisst, in 2.5 Jahren hat sich
die Investition schon gelohnt. Im Jahre 2015 wird diese Zelle nur noch 15 US-Cent kos-
ten. Der Strom aber wird 25 US-Cent kosten pro kWh. Das heisst, Stromkosten von 3 bis
4 Monaten amortisieren eine Investition für 25 Jahre. Das ist eklatant. Man weiss, um
den Weltenergiebedarf zu decken, sind Solarzellen in der Grössenordnung eines Drittels
der Fläche von Spanien nötig. (...) Bilden die einzelnen Elemente nun ein infor-
mationstechnisches System, so kann ich mir überlegen, ob ich meinen Altbau zusätzlich
dämmen soll, oder einfach Solarzellen in Spanien oder anderswo kaufen soll. Diese
Preisfrage ist jetzt schon entschieden, gegen die Dämmung. All das geht nicht ohne
Computer. Diese neue Formen von Energietechnik und dezentraler Automationstechnik
werden das heutige Bild vom Planen und Bauen nachhaltig umkrempeln.
Dies bedingt eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Fachplanern und
Architekten ...
... oder eben nicht, der Architekt kann wieder machen, das er will. Durch die stark hier-
archischen Systeme von Leitungen und Medien in den Häusern müssen die Fachplaner
immer sehr genau planen und dann geht es ja immer nicht auf, es ist ja alles meist recht
fürchterlich auf der Baustelle. Die Leitungen kriegen wenig Platz, sind an den unmög-
lichsten Stellen, man kommt nicht ran usw., am Ende gibt's nur Ärger, der kostet einen
Haufen Geld und funktioniert nicht richtig. Durch den Einsatz von Informationstechnik

Anhang XIII
——————————————————————————————————————————
entspannt sich das. Die Apparate werden einfach mit Energie und Informationen ver-
sorgt. Die sind dann schlau genug, als die dann machen, was sie wollen, bzw. müssen.
Automationstechniken können überall dort eingesetzt werden, wo alles bekannt ist, was
links und rechts passiert und die Prozesse einfach sind. Das Phänomen an der Arbeit in
Kontinentaleuropa, insbesondere in der Schweiz ist die Tatsache, dass alles extrem ver-
netzt ist. Jedes Haus ist im Gegensatz zu Bauten in den USA ein sehr differenziertes, öf-
fentliches Anliegen. Dies macht auch die Qualität der Bauten aus. Es ist auch ein gros-
ses Anliegen, dass Leute, die handwerklich etwas können, dies auch zeigen. Deshalb ist
die Planung hier nicht ideal, man ist permanent am Verhandeln, wie das Gebäude aus-
zusehen hat. Wäre alles bekannt, könnte man Automaten bauen. Die Planung über die
kulturellen Grenzen hinweg vergleichen zu wollen, ist tatsächlich Apfel mit Birnen zu
vergleichen. Der unterschiedliche Gebrauch des Computers und andere Arbeitsweisen
erklären noch nicht alles. Wichtig ist zu schauen, in welchem Kontext Häuser erstellt
werden und was die Leute unter Architektur verstehen.
In diesen Bereichen arbeiten wir hier, dies sind die neuen Herausforderungen für die
Büros, hier werden Innovationsschübe kommen, unweigerlich. Zuerst hatten wir das mit
dem CAD, dann Multimedia, jetzt kommen die computergesteuerten Produktionen und
Modellbaumöglichkeiten für Freiformflächen usw. Diese Dinge finden in systematisier-
ter Art und Weise Einzug in die Büros. Durch den Einsatz neuer Energien und Automa-
tionstechniken wird der Einsatz neuer Bauteile dann deutlich modularer und flexibler
und gleichwohl ökologischer, hochwertiger und sicherer.
Welche Punkte würden aus Ihrer Sicht diesen geschilderten Prozess der zunehmenden
Digitalisierung beschleunigen?
(...) Das interessante aus ökonomischer Sicht ist, dass bei diesen ganzen vorgelagerten
Entwurfssachen wie CAD oder 3D-Modellierungen kein Geld (mehr) verdient werden
kann. Hingegen ist bei der digitalen Produktion und vor allen bei den neuen Automati-
onstechniken schon eher richtig Musik drin. Je mehr man über den Entwurf hinaus
geht, desto mehr funktionieren die Dinge aus ökonomischer Sicht. Nach vorne ist das
ökonomische Modell im Entwurfsprozess, was sehr plausibel ist, dasjenige welches jetzt
mit dem CRB modelliert wurde. Architekten und ihre individuelle Kreativität werden
miteinander vernetzt. Das ist viel besser, als ihnen Automaten an die Hand zugeben und
ihren Entwurf zu automatisieren. Der Clou und auch die Wertschöpfung im Entwurf
liegt eher in der Vernetzung und darin, Wissen zu makeln. Wenn jemand beispielsweise
an einem Problem knobelt, ihn darauf hinzuweisen, dass drei von seinen Kollegen sich
schon darüber den Kopf zerbrochen haben. Das ist richtig viel Wert, oder frag doch mal
diese Firma, nicht diese. (...) Im Moment sind die Geschäftsmodelle bei der Vernetzung
im Entwurf, nicht beim CAD, und hinten in der Ausführung bei der Entrümpelung der

Anhang XIV
——————————————————————————————————————————
Technik aus den Häusern, also dass die Gebäude 'smart' werden, darin sind richtig
hohe Wertschöpfungen zu erzielen.
Wer behält letzlich die Kontrolle im klassischen Sinne über den Entwurf und die Projek-
tierung?
Keiner, bzw. der- oder diejenige, die es kann. Vielleicht kann es der individuelle Archi-
tekt. Diese Netzwerke sind erst dann leistungsfähig, wenn sie sich nicht nach starren
Regeln organisieren, deshalb auch nicht nach Hierarchien. Die Arbeitsweise ist eher
klimatisch, das heisst bestimmte Themen und Lösungswege liegen da und derjenige der
es schafft, den nächsten Schritt zu machen, der macht ihn dann. Auch bei Wikipedia
sagt niemand, dass man was schreiben muss.
Wie geht man in diesem Zusammenhang um mit den Begriffen Verantwortung oder Ur-
heberrecht?
Das sind jetzt die richtig schönen Forschungsthemen. Aber auch das wird sich geben.
Wo denken Sie, steht das Berufsbild des Architekten in 20 Jahren?
Ich glaube nicht, dass es sich radikal verändert. So wie es trotz Internet immer noch Bi-
bliotheken gibt, verlagert sich die Entwicklung einfach in die genannten Richtungen.
Leichte Veränderungen, eher eine schleichende Migration ist wahrscheinlich als dass es
radikale Umbrüche geben wird. Nach 20 Jahren wird man dann denken, wie komisch es
vor 20 Jahren war, aber die Entwicklung wird nachvollziehbar und stetig ablaufen.

Literatur- und Datenverzeichnis XV
——————————————————————————————————————————
Literatur- und Datenverzeichnis
Ballard, Glenn / Tommlein, Iris / Koskela, Lauri / Howell, Greg (2002): Lean construc-
tion tools and techniques [in: Best, Rick / De Valence, Gerard (Hrsg.): Design And Con-
struction – Building in Value; Oxfort, 2002; S. 227-254]
Bloch, Ernst (1985): Das Prinzip Hoffnung, Werkausgabe: Band 5; Frankfurt am Main,
1985.
Bortz, Jürgen / Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluation – für Hu-
man- und Sozialwissenschaftler; 4., überarbeitete Auflage, Heidelberg, 2006.
Chalmers, Alan F. (2007): Wege der Wissenschaft – Einführung in die Wissenschafts-
theorie [englische Originalausgabe: What is This Thing Called Science?, St. Lucia,
Queensland, 1976]; 6., verbesserte Auflage, Berlin Heidelberg, 2007.
CUREM (2004): Best-Owner-Prinzip; Center for Urban and Real Estate Management –
Zurich, 2004 <http://www.curem.ch/pdfs/Best-Owner-Prinzip.pdf>, Abrufdatum
16.06.2009, 16.25 Uhr.
Eastman, Chuck / Teicholz, Paul / Sacks, Rafael / Liston, Kathleen (2008): BIM Hand-
book – A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers,
Engineers and Contractors; New Jersey USA, 2008.
El-Mashaleh, Mohammad S. (2007): Benchmarking Information Technology Utilization
in the Construction Industry in Jordan, [in: Journal of Information Technology in Con-
struction, Itcon Vol. 12, S. 279-291];
<http://www.itcon.org/data/works/att/ 2007_19.content.09798.pdf >; Abrufdatum:
12.05.2009, 17.20 Uhr.
Geltner, David M. / Miller, Norman G. / Clayton, Jim / Eichholtz, Piet (2007): Commer-
cial Real Estate – Analysis and Investments; 2nd Edition, Mason USA, 2007.
Goh, Bee Hua (2004): IT-Barometer 2003: Survey of Singapore Construction Industry
and a Comparison of Results, [in: Journal of Information Technology in Construction,
Vol 1, 2005], <http://www.itcon.org/2005/1/>, Abrufdatum: 03.05.2009, 17.40 Uhr; Sin-
gapur, 2004.
Gramazio, Fabio / Kohler, Matthias (2008): Digital Materiality in Architecture; Baden,
2008.

Literatur- und Datenverzeichnis XVI
——————————————————————————————————————————
Hebeisen, Walter (1999): F. W. Taylor und der Taylorismus – über das Wirken und die
Lehre Taylors und die Kritik am Taylorismus; Zürich, 1999.
Howard, Rob / Kiviniemi, Arto / Samuelson, Olle (1998): Surveys of IT in the Con-
struction Industry and Experience of the IT Barometer in Scandinavia, [in: Journal of
Information Technology in Construction, Itcon Vol. 3, S. 45-56];
<http://www.itcon.org/1998/4/paper.pdf>, Abrufdatum 11.05.2009, 16.40 Uhr.
Kalay, Yehuda E. (2004): Architecture‘s new media: Principles, theories and methods
of computer aided design; Massachusetts USA, 2004.
Kiviniemi, Arto et al. (2008): Review of the Development and Implementation of IFC
compatible BIM;
<http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Sara/fi/Dokumenttia
rkisto/Viestinta_ja_aktivointi/Loppuraportti_aineistot_2007/Erabuild_BIM_Final_Repo
rt_January_2008.pdf>, Abrufdatum: 03.05.2009, 17.20 Uhr.
Kolarevic, Branko (Ed.) (2003): Architecture in the digital age: design and manufactu-
ring; New York USA, 2003.
Liker, Jeffrey K. (2008): Der Toyota Weg – 14 Managementprinzipien des weltweit er-
folgreichtsten Automobilkonzerns [englische Originalausgabe: The Toyota Way, 2004];
5., unveränderte Auflage, München, 2008.
Lindsey, Bruce (2001): Digital Gehry – Material Resistance / Digital Construction; Ba-
sel, 2001.
Meyer-Meierling, Paul (1999): Gesamtleitung von Bauten; Verf.: Paul Meyer, Mitarb.:
Stefan von Arb … , Zürich, 2000.
Moelle Herbert (2006): Rechnergestützte Planungsprozesse der Entwurfsphasen des Ar-
chitekten auf Basis semantischer Modelle; Dissertation am Institut für Entwerfen und
Bautechnik, Fakultät für Architektur, Technische Universität München;
<http://architektur-informatik.scix.net/data/works/att/5240.content.05861.pdf>, Abruf-
datum 5. Juli 2009, 16.20 Uhr.
Oladapo, Adebayo A. (2007): An Investigation into the Use of ICT in the Nigerian Con-
struction Industry, [in: Journal of Information Technology in Construction, Itcon
Vol.12, S. 261-277]; <http://www.itcon.org/data/works/att/2007_18.content.02391.pdf>;
Abrufdatum: 12.05.2009, 17.30 Uhr.

Literatur- und Datenverzeichnis XVII
——————————————————————————————————————————
Pfeiffer, Werner (1993): Rationalisierung, in: Wittmann, Waldemar (Hrsg.): Handwör-
terbuch der Betriebswirtschaft, 5. Aufl., 3. Bd.; Stuttgart, 1993.
Pfeiffer, Werner / Weiss, Eno (1994): Lean Management: Grundlagen der Führung und
Organisation lernender Unternehmen; 2., überarb. und erw. Aufl.; Berlin, 1994.
Rifkin, Jeremy (2001): Das Ende der Arbeit – und ihre Zukunft; [englische Originalaus-
gabe: The End of Work, New York, 1995]; Franfurt am Main, 2001.
Rivard, Hugues (2000): A Survey of the Impact of Information Technology on the Cana-
dian Architecture, Engineering and Construction Industry, [in: Journal of Information
Technology in Construction, Itcon Vol. 5, S. 37-56];
<http://www.itcon.org/2000/3/paper.pdf>, Abrufdatum 12.05.2009, 11.30 Uhr.
Rossig, Wolfram E. / Prätsch, Joachim (2008): Wissenschaftliche Arbeiten – Leitfaden
für Haus- und Seminararbeiten, Bachelor- und Masterthesis, Diplom- und Magisterar-
beiten, Dissertationen; Achim, 2008.
Samuelson, Olle (2002): IT-barometer 2000 – The Use of IT in the Nordic Construction
Industry, [in: Journal of Information Technology in Construction, ITcon Vol. 7, S. 1-26];
<http://www.itcon.org/2002/1/>, Abrufdatum: 02.05.2009, 20.30 Uhr; Helsinki, 2002.
Samuelson, Olle (2008): The IT-barometer – a decade's development of IT use in Swe-
dish construction sector, [in: Journal of Information Technology in Construction, ITcon
Vol. 13, S. 1-19]; <h ttp://www.itcon.org/2008/1 >, Abrufdatum: 02.05.2009, 20.20 Uhr;
Helsinki, 2008.
Schmid, Peter (2007): Kostengarantie SIA/BSA: alle gewinnen;
<http://www.sia.ch/d/aktuell/news/20070205_kosten.cfm>, Abrufdatum: 12.06.2009,
12.20 Uhr.
Schneider, Wolf (2001): Deutsch für Profis – Wege zu gutem Stil; 14. Auflage, Mün-
chen, 2001.
Schodek, Daniel / Bechthold, Martin / Griggs, Kimo / Kao, Kenneth Martin / Steinberg,
Marco (2005): Digital Design and Manufacturing – CAD / CAM Applications in Archi-
tecture and Design; New Jersey USA, 2005.
Schulte, Karl-Werner / Bone-Winkel, Stephan / Thomas, Matthias (2005): Handbuch
Immobilieninvestition, 2. Auflage, Köln, 2005.

Literatur- und Datenverzeichnis XVIII
——————————————————————————————————————————
Sullivan, John (2007): A Survey of BIM Programs at U.S. Federal Government Agen-
cies, <http://augiru.augi.com/content/library/au07/data/paper/GV110-1.pdf>,
Abrufdatum: 03.05.2009, 14.00 Uhr; Washington, 2007.
Taleb, Nassim Nicholas (2008): Der Schwarze Schwan – Die Macht höchst
unwahrscheinlicher Ereignisse [englische Originalausgabe: The Black Swan – The
Impact of the Highly Improbable, New York, 2007]; München, 2008.
Tas, Elcin Filiz (2007): A Survey of the Use of IT in Builing Product Information Acqui-
sition in Turkey, [in: Journal of Information Technology in Construction, Itcon Vol. 12,
S. 323-335]; <http://www.itcon.org/2007/22>, Abrufdatum: 11.05.2009, 16.20 Uhr;
Istanbul, 2007.
Waters, John K. (2003): Blobitecture – Waveform architecture and digital design;
Massachusetts USA, 2003.

Ehrenwörtliche Erklärung XIX
——————————————————————————————————————————
Ehrenwörtliche Erklärung
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Masterthesis
'Der Digitalisierungsgrad der Schweizer Architekturbüros'
selbst angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen
Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht
veröffentlicht.
Zürich, den 14. August 2009
______________________