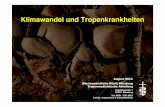Identity Fusion: The Interplay of Personal and Social...
Transcript of Identity Fusion: The Interplay of Personal and Social...

Volker Gahrau (0947835), Karoline Paier (1104540), Steffen Volkmer (0707386) !
Universität Wien
Identity Fusion:
The Interplay of Personal and Social
Indentities in Extreme Group Behaviour
William B. Swann, Jr., Ángel Gómez, D. Conor Seyle, J.
Francisco Morales & Carmen Huici
Seminararbeit
200027 PS Proseminar Sozialpsychologie
LV-Leiter: Andreas Olbrich-Baumann
WS 2012
Fakultät für Psychologie
Vorgelegt von:
Volker Gahrau (0947835), [email protected]
Karoline Paier (1104540) [email protected]
Steffen Volkmer (0707386) [email protected]
Wien, 21.11.12

!
!
Plagiatserklärung
„Hiermit erklären wir, die vorgelegte Arbeit selbständig verfasst und ausschließlich die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle wörtlich oder dem Sinn nach
aus anderen Werken entnommenen Textpassagen und Gedankengänge sind durch genaue
Angabe der Quelle in Form von Anmerkungen bzw. In-Text-Zitationen ausgewiesen. Dies
gilt auch für Quellen aus dem Internet, bei denen zusätzlich URL und Zugriffsdatum
angeführt sind. Uns ist bekannt, dass jeder Fall von Plagiat zur Nicht-Bewertung der
gesamten Lehrveranstaltung führt und der Studienprogrammleitung gemeldet werden
muss. Ferner versichern wir, diese Arbeit nicht bereits andernorts zur Beurteilung
vorgelegt zu haben.“
Wien, 21.11.12, Volker Gahrau, Karoline Paier, Steffen Volkmer

!
!"!
Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Modell der Identitäts-Fusion. Es
soll die Frage geklärt werden, was Menschen dazu veranlasst, ihr eigenes Wohl dem der
Gruppe unterzuordnen. Dazu wurde mit Hilfe von Experimenten ermittelt, dass bei
fusionierten Menschen die persönliche und soziale Identität funktional äquivalent sind und
egal welche man aktiviert, sich dies auf die andere auswirkt. Die bildliche Messmethode
der Fusion wird zu einer zuverlässigeren, sprachlichen Methode weiterentwickelt.
Außerdem wird auf den Unterschied zwischen Identitäts-Fusion und der Theorie der
sozialen Identität eingegangen. Obwohl sie verwandt sind, laden sie auf unterschiedliche
Faktoren und erklären verschiedene Phänomene. Die Identitäts-Fusion vermag besser
extremes Pro-Gruppen-Verhalten vorauszusagen. Weiterhin werden die Natur und die
Mechanismen der Fusion und der daraus resultierenden Handlungen detaillierter erklärt,
sowohl Gefühle von Verantwortung und Unverwundbarkeit, als auch der körperliche
Erregungszustand spielen dabei eine wichtige Rolle.

!
!#!
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 6
2. Identity Fusion: The Interplay of Personal and Social Identities 7
in Extreme Group Behaviour (2009)
2.1. Identitäts-Fusion 8
2.2. Theoretischer Hintergrund 9
2.3. Zielsetzung 10
2.4. Fusion messen 10
2.5. Experiment 1 12
2.5.1. TeilnehmerInnen und Methode 12
2.5.2. Ergebnisse 14
2.6. Experiment 2 16
2.6.1. TeilnehmerInnen und Methode 16
2.6.2. Ergebnisse 17
2.7. Experiment 3 19
2.7.1. TeilnehmerInnen und Methode 19
2.7.2. Ergebnisse 20
2.8. Diskussion 22
3. Zusatztext 1: Identity Fusion and Self-Sacrifice: Arousal as a Catalist 23
of Pro-Group-Fighting, Dying and Helping Behavior (2010)
3.1. Experiment 24
3.2. Teilnehmer/innen und Methode 24
3.3. Ergebnisse 24
3.4. Diskussion 26
4. Zusatztext 2: On the Nature of Identity Fusion: Insights Into 26
the Construct and a New Measure (2011)
4.1. Theorie 27
4.2. Studien 28
4.3. Ergebnisse 31
5. Zusatztext 3. When Group Membership Gets Personal: 32
A Theory of Identity Fusion (2012)
5.1. Vier Prinzipien der Identitäts-Fusion 33
5.2. Gründe für eine Identitäts-Fusion 34

!
!$!
5.3. De-Fusion 36
5.4. Fusion – Gut oder Böse? 36
6. Verbindung der Texte 37
7. Kritik und Anwendung 38
8. Literaturverzeichnis 40
9. Abbildungsverzeichnis 41

!
!%!
1. Einleitung
Unsere heutige Welt ist geprägt durch terroristische Anschläge; ob es sich um die
tragischen Ereignisse des 11. September 2001 handelt, ob es die Anschläge in Madrid
(2004) und London (2005) sind oder ob über Konflikteskalationen am Gaza-Streifen
berichtet wird. Genau diese Berichte führen bei Menschen oft zu Ratlosigkeit und
Unverständnis und werfen einige Fragen auf.
Der Hauptartikel, mit dem sich diese Seminararbeit auseinandersetzt, nimmt sich genau
diesen Ereignissen an. Die ForscherInnen stellen sich eine Frage, die viele Menschen
beschäftigt: Was bewegt Menschen dazu sich für eine Gruppe zu opfern?
Welche Motivation treibt die Person, die sich samt eines Flugzeugs in ein öffentliches
Gebäude stürzt? Wieso sprengen sich Selbstmordattentäter in die Luft?
Allgemeiner formuliert, wie beeinflusst die Gruppenzugehörigkeit das Verhalten eines
Menschen und welche Rolle spielt der einzelne Mensch in der Gruppe?
William B. Swann und seine Kollegen haben es sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe einer von
ihnen entwickelten Theorie dieses Verhältnis zu erklären.
In der folgenden Seminararbeit werden wir uns mit genau jener Theorie, nämlich der
„Identitäts-Fusion“ beschäftigen.
Swann et al. (2009) stellen die Hypothese auf, dass Menschen eher zu extremen Pro-
Gruppen-Verhalten neigen, wenn sie eine Identitäts-Fusion erlebt haben. Wenn das der
Fall ist, sind ihre persönliche und ihre soziale Identität gleichgestellt. Daraus erschließt
sich die nächste Hypothese, nämlich dass egal welche dieser Identitäten aktiviert wird,
fusionierte Personen eher zu Gruppen befürwortendem Verhalten neigen. Des Weiteren
möchten sie nachweisen, ob es sein könnte, wenn diese Identitäten funktional gleichgestellt
sind, dass dieses Zusammenwirken jenes außergewöhnliche Gruppen-Verhalten fördert.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Weiterentwicklung der Identitäts-Fusion und den Verlauf der
Forschung mit Hilfe von vier Artikeln darzustellen. Ausgehend von dem Artikel Identity
Fusion: The Interplay of Personal and Social Self in Extreme Group Behaviour (2009)
haben wir drei Folge-Artikel ausgewählt, welche das Thema noch weiter vertiefen sollen:
1) Identity Fusion and Self-Sacrifice: Arousal as a Catalist of Pro-Group-Fighting, Dying
and Helping Behavior (2010), 2) On the Nature of Identity Fusion: Insights Into the

!
!&!
Construct and a New Measure (2011), 3) When Group Membership Gets Personal: A
Theory of Identity Fusion (2012).
Wir werden uns mit den theoretischen Differenzierungen, den erweiterten Messmethoden
und den neuen Perspektiven, die jene Artikel enthalten, auseinandersetzen.
Zudem gehen wir auch kritisch auf diese Studien ein, heben positive wie negative Aspekte
hervor und beschäftigen uns mit möglichen Anwendungsbereichen.
2. Identity Fusion: The Interplay of Personal and Social Identities in
Extreme Behaviour (2009)
Die Studie Identity Fusion: The Interplay of Personal and Social Self in Extreme Group
Behaviour wurde im Jahr 2009 in der Zeitschrift Journal of Personality and Social
Psychology (Vol.96) veröffentlicht. Die AutorInnen waren William B. Swann, Jr.
(University of Texas, Austin), D. Conor Seyle (University of Texas, Austin), Ángel Gómez
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED) und J. Francisco Morales und
Carmen Huici (UNED). Der folgende Teil dieser Arbeit bezieht sich komplett auf diesen
Artikel. (Swann et al., 2009)
Wie schon angemerkt, stellten sich diese AutorInnen die Frage, was Menschen dazu
bewegt sich für eine Gruppe zu opfern.
In der psychologischen Literatur ist die gängigste Antwort auf diese Fragestellung, dass
solche extremen Handlungen vordergründig von Menschen, die ein schwaches Selbstbild
besitzen, ausgeführt werden. (e.g. Kaplan, 1981).
Jedoch wurde schon in Mark Sagemans Buch Unterstanding Terror Networks gezeigt, dass
diese These nicht mehr bedingungslos haltbar ist. (Sageman, 2004)
Auf Grund dessen haben es sich Swann et al. zum Ziel gesetzt eine Gegenthese zu dieser
Annahme zu entwickeln.
Ihre These ist, dass es eben nicht unsichere Menschen sind, die fähig wären sich selbst für
die Gruppe zu opfern. Solche extremen Handlungen werden eher von Menschen, die ein
starkes und sicheres Selbstbewusstsein besitzen und zudem eine Identitäts-Fusion erlebt
haben ausgeführt.

!
!'!
2.1. Identity-Fusion
Die Identity-Fusion ist ein Konzept, das eine bestimmte Form der Identifikation und
Verbundenheit mit einer Gruppe erklärt. Des Weiteren bietet es eine neue Erklärung für
das Wirken und Zusammenspiel von sozialer und persönlicher Identität.
Swann et al. stützen sich auf die Grundannahme, dass Menschen persönliche (zum Beispiel
intelligent, sportlich) und soziale (zum Beispiel DemokratIn, SpanierIn) Identitäten haben.
Obwohl beide Identitäten ein Teil eines größeres Verständnis des Selbst sind, ziehen die
meisten Menschen eine strikte Linie zwischen ihnen. Bei Personen mit fusionierten
Identitäten ist dies jedoch nicht der Fall.
Um diesen Unterschied besser verstehen zu können, führen Swann et al. eine Analogie ein:
Wie die Haut den Körper vom Rest der Welt trennt, so trennt auch eine psychologische
Linie die persönliche von der sozialen Identität.
Bei Personen, die eine Identitäts-Fusion erlebt haben, verschwimmt diese Grenze. Auf
Grund dieser nicht mehr existierenden Trennung sind beide Identitäten funktional
gleichgestellt und können zur selben Zeit aktiv sein. Was zur Folge hat, dass die Gruppe
ihnen genau so wichtig wird, wie das Selbst.
„In short, when called upon supreme sacrifices for the group, people must be inclined to
ask not what the group can do for them, but what they can do for the group.“ (Swann et al.,
2009, S.996)
Genau diese Eigenschaft, seine eigenen Interessen mit denen der Gruppe gleichzustellen
oder diese sogar über die eigenen zu stellen, ist maßgeblich für die Beantwortung der
Frage, wie es zu extremem Verhalten kommen kann. Eine solche extreme Handlung wäre
zum Beispiel für die Gruppe zu sterben oder zu kämpfen. Swann et al. nehmen an, dass es
wahrscheinlich nicht genug ist, nur zu bemerken, dass man viel gemeinsam mit einer
Gruppe und deren Mitgliedern hat. Zu diesen herausragenden Taten neigen Personen erst,
wenn sie eine Identitäts-Fusion erlebt haben. Ist dies der Fall empfindet die Person eine
weitaus stärkere Verbundenheit mit der Gruppe.
Kurz gesagt, die Theorie der Identitäts-Fusion besagt, dass Menschen, deren persönliche
und soziale Identität funktional gleichgestellt und gleichwertig sind, eher zu extremen Pro-

!
!(!
Gruppen-Verhalten neigen.
2.2. Theoretischer Hintergrund
Um das Konzept der Identitäts-Fusion zu stärken beziehen sich Swann et al. auf einige
bekannte sozialpsychologische Modelle, wie zum Beispiel die Social Identity Theory, die
Self-Categorization Theory und die Self-Verification Theory.
Die Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979) und die Self-Categorization Theory
(Turner et al., 1987) bilden zwar den Grundstein für die Identitäts-Fusion, in dem sie die
Unterscheidung von sozialem und persönlichem Selbst aufbringen und beschreiben; die
AutorInnen möchten sich jedoch auch sehr bestimmt von diesen Theorie abgrenzen.
Die Social Identity Theory ist eine Theorie, die Gruppenzugehörigkeit und Beziehungen
innerhalb einer Gruppe beschreibt. (Hogg & Vaughan, 2008, S.125) Die Self-
Categorization Theory beschreibt hingegen den Prozess, wie durch die Kategorisierung als
Gruppenmitglied eine soziale Identität entsteht und welche Auswirkungen das auf das
Gruppenverhalten hat. (Hogg & Vaughan, 2008, S.122)
Swann et al. stimmen in einigen Punkten mit diesen Theorien überein, in anderen haben sie
eine andere Meinung.
Eine Übereinstimmung wäre zum Beispiel die Identifikation mit einer Gruppe als
Voraussetzung für extremes Verhalten. Auch in der Identitäts-Fusion ist die Identifikation
eine wichtige Komponente, die Fusion geht jedoch noch weiter und bringt ganz andere
Motivationen mit sich.
Ein Punkt, in welchem sie nicht übereinstimmen ist der Prozess der Depersonalisation. In
der Social Identity Theory wird die Depersonalisation als ein Prozess beschrieben, in
welchem das persönliche Selbst durch das Soziale ersetzt wird. Menschen, die sich stark
mit ihrer Gruppen identifizieren, verlieren in dieser ihr persönliches Selbst und orientieren
ihr Verhalten an dem, was in der Gruppe als Prototyp gesehen wird. Sie sehen sich und
andere nicht mehr als einzigartige Individuen, sondern als Gruppenmitglieder oder Nicht-
Gruppenglieder. (Hogg &Vaughan, 2008, S.409)
Bei fusionierten Menschen ist das jedoch nicht der Fall. Sie behalten ihr Gefühl für ihre
persönliches Selbst, sowie ihr Selbstbewusstsein und sind erst dadurch bereit extremes und
außergewöhnliches Verhalten auszuführen.

!
!)*!
Swann et al. geben zudem an, dass sie ein fundamental unterschiedliches Verständnis von
dem Zusammenspiel zwischen persönlicher und sozialer Identität vertreten als das der
Social Identity Theory. Dies lässt sich leicht am Prinzip des Funktionalen Antagonismus
erklären. Dieses Prinzip erklärt in der Social Identity Theory, dass je nach dem welche der
Identitäten bewusst gemacht wird, diese auch bedeutsamer wahrgenommen wird als die
andere. (Hogg &Vaughan, 2008) Es ist also ein Gegenspiel der beiden Identitäten, die sich
gegenseitig schwächen.
Bei der Identitäts-Fusion wird das jedoch ausgeschlossen, die verschiedenen Identitäten
bestärken einander eher, als dass sie sich bekämpfen würden.
Die dritte und letzte Theorie, die eine wichtige These der Identitäts-Fusion unterstützt, ist
die Self-Verification Theory (z.B.: Swann, 1987). Diese besagt, dass unsere Identität
maßgeblich dadurch beeinflusst ist, wie andere auf diese reagieren. (Hogg & Vaughan,
2008, S.128)
In diesem Artikel soll gezeigt werden, dass diese Annahme auch für das Gruppenverhalten
gilt.
2.3. Zielsetzung
Die Ziele der Studie sind zu zeigen, dass a) die Identitäts-Fusion eine besondere Form der
Loyalität gegenüber einer Gruppe ist, b) persönliche und soziale Identität dieser Personen
funktional gleich gestellt sind, c) es keinen Unterschied machen sollte, welche dieser
Identitäten man aktiviert, in jedem Fall sollte es die Wahrscheinlichkeit von extremen
Handlungen für die Gruppe steigern und d) wenn persönliche und soziale Identität sich
ergänzen, solche extremen Handlungen hervorgerufen werden.
Um das zu erreichen musste als Erstes ein valides Messinstrument für die Fusion
entwickelt werden. Es wurde in fünf Vorstudien und drei Hauptexperimenten erforscht in
wie weit die Thesen bestätigt werden können.
2.4. Fusion messen
Swann und Kollegen versuchen nachzuweisen, dass Personen trotz Fusion ihrer
persönlichen und sozialen Identität, ihre persönliche Identität nicht aufgeben, sondern
beide Identitäten funktionell gleichgestellt sind. Sie postulieren, dass ein starkes,

!
!))!
gefestigtes Selbst in Verbindung mit der funktionellen Gleichstellung der Identitäten die
Wahrscheinlichkeit extremen Verhaltens zugunsten der Gruppe erhöht. Gleichzeitig wird
angenommen, dass Identitätsfusion von Identifikation mit der Gruppe abzugrenzen ist, da
letztere nicht unbedingt ein Gefühl der Einheit mit selbiger voraussetzt. Daraus ergibt sich
die Frage, wie sich diese Hypothese testen und die Fusion der beiden Identitäten
nachweisen lässt.
In Ermangelung eines für diese Zwecke nutzbaren Messinstruments entwickelten Swann
und Kollegen aus einer ursprünglich von Schubert und Otten (2002) entworfenen Methode
eine eigene, ebenfalls bildliche Skala, deren einziger Zweck die Feststellung der
subjektiven Empfindung von Überlappung des Selbst- mit der Gruppe ist. Der Vorteil
dieser Methode ist, dass eine vollständige Überlappung der beiden Einheiten, persönlicher
und sozialer Identität, möglich ist, beide aber als solche erhalten bleiben.
Swann et al. (2009)
Fünf Vorstudien mit spanischen Versuchspersonen konnten grundlegende Annahmen der
Forscher über die Skala bestätigen. Identitätsfusion ist kein Persönlichkeits-Trait, sondern
vielmehr auf eine bestimmte Gruppe gerichtet, fusionierte Personen weisen eine besonders
hohe Bereitschaft auf extremes Verhalten zugunsten dieser Gruppe zu zeigen und, obwohl
Fusion mit Identifikation mit der Gruppe korreliert, ist sie eine davon abzugrenzende,
einzigartige Form der Einheit mit der Gruppe. Zudem kann die Variable „Fusion“ als
dichotome Variable verwendet werden.
Abbildung 1: Messinstrument für Identitätsfusion

!
!)+!
Die Drei Experimente
Im folgenden Abschnitt wird die Hauptuntersuchung der Forschung von Swann, Gomez,
Seyle, Morales und Huici aufgeführt. Diese gliedert sich in drei Teile. Die drei
Experimente weisen große Parallelen auf, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich wichtiger
Einzelheiten.
2.5. Experiment 1
Das erste Experiment stellt die Frage, ob eine Provokation der persönlichen Identität – von
einem Gruppenmitglied ausgehend – extremes Pro-Gruppenverhalten verstärkt, respektive
hervorruft (im englischen Original: "Will a Challenge of a Personal Identity From an
Ingroup Member Increase Extreme Pro-Group Behavior?").
Dazu hat man ein 2x2-Faktoren Studiendesign gewählt. Die TeilnehmerInnen waren
fusioniert oder nicht-fusioniert und ihre persönliche Identität wurde entweder verifiziert
oder provoziert ("challenged").
2.5.1. TeilnehmerInnen und Methode
Die Versuchspersonen waren spanische Studierende, die an der Onlinestudie teilnahmen
und Creditpoints dafür bekamen. Das Experiment hatte zwei Durchgänge mit einem
Abstand von 4-5 Monaten. Letztendlich nahmen 602 Personen an dem kompletten
Experiment teil, davon 520 Frauen und 82 Männer mit einem Durchschnittsalter von 31.17
Jahren.
Wie bereits erwähnt bestand die Untersuchung aus zwei Durchgängen. Im ersten
Durchgang wurden persönliche Identitätsmerkmale der TeilnehmerInnen und die
Fusionierung und Identifikation mit ihrem Heimatland Spanien erhoben.
Außerdem wurde gefragt ob sich die TeilnehmerInnen als Prototyp der Gruppe (Spanien)
sahen. Dies wurde mit folgendem Item erhoben: "In welchem Ausmaß sehen Sie sich als
prototypisches Mitglied der Gruppe an?" (Im englischen Original: "To what extent do you
consider yourself a prototypical member of your group?"). Man konnte dann auf einer
Skala von 1 ("überhaupt nicht") bis 10 ("sehr stark") angegeben, wie stark dies zutrifft.

!
!)"!
Man geht davon aus, dass fusionierte Personen sich eher nicht als Prototypen der Gruppe
sehen, sondern als einzigartig, da sie der Theorie zufolge zu außergewöhnlichem,
extremem Pro-Gruppenverhalten in der Lage sind.
Die persönlichen Identitätsmerkmale wurden mit Hilfe von fünf
Persönlichkeitsmerkmalen, sogenannten "negative traits" ermittelt. Dazu mussten die
TeilnehmerInnen eben solche fünf negativen Merkmale niederschreiben, die sie glauben
selbst zu besitzen. Die meist genannten waren hierbei "schüchtern", "unsicher", "stur",
"nervös" und "misstrauisch". Im Anschluss daran sollte zu jedem dieser Merkmale ein
Beispieltext geschrieben werden, in dem der/die TeilnehmerIn beschreibt wann er/sie sich
so fühlt, ohne jedoch das entsprechende Merkmal darin wörtlich zu nennen.
Im zweiten Durchgang bekamen die TeilnehmerInnen fingiertes Feedback von einer/m
EvaluatorIn, der aus ihrer Gruppe entstammt – also einem spanischen Mitmenschen.
Dieser hatte vorgeblich die Beispieltexte zu den "traits" gelesen und aufgrund derer eine
Aussage über die Persönlichkeit der TeilnehmerInnen getroffen. Es wurden keine genauen
Aussagen getroffen, sondern nur in welche Richtung die Persönlichkeit tendiert. Dabei gab
es nur zwei Fälle und die TeilnehmerInnen – sowohl fusionierte als auch nicht-fusionierte
– wurden zufällig einem von beiden zugeordnet.
Fall 1 war der verifizierende Fall, in dem 4 von 5 angegebenen traits "richtig" erkannt
wurden.
Fall 2 hingegen war der provozierende Fall, in dem nur 1 von 5 traits "richtig" erkannt
wurde; das restliche Feedback war positiver als die von dem/der TeilnehmerIn getroffene
Aussage. So wurde eine innere Diskrepanz erzeugt und damit die persönliche Identität
aktiviert.
Im Anschluss daran wurde ein Manipulationscheck des Selbstbildes durchgeführt, indem
die TeilnehmerInnen gefragt wurden, ob der/die EvaluatorIn sie so sieht, wie sie sich selbst
sehen. Wäre dies nämlich der Fall bei einem provozierenden Feedback, wären die
entsprechenden Daten natürlich nicht aussagekräftig, da dass Feedback keine innere
Diskrepanz hervorgerufen hätte.
Letztendlich folgt die eigentliche Messung des Experiments, bei der mithilfe einer 7-Item-
Skala die Bereitschaft der TeilnehmerInnen für die Gruppe a) zu kämpfen und b) zu
sterben erhoben wurde.

!
!)#!
2.5.2. Ergebnisse
Bei der Messung der Fusionierung kam heraus, dass 237 TeilnehmerInnen fusioniert
waren, 365 hingegen nicht.
Die Korrelation zwischen Identitätsidentifikation und Fusion war verhältnismäßig, bei der
Frage nach dem Prototypen der Gruppe und der Fusion mit der Gruppe bestand keine
Korrelation.
Der Manipulationscheck des Selbstbildes ergab, dass – bei der provozierten Gruppe im
Vergleich mit der verifizierten Gruppe – nicht der Fall vorlag, dass der/die EvaluatorIn die
TeilnehmerInnen sah, wie sie sich selbst sahen. Dementsprechend waren die Daten
aussagekräftig.
Die Ergebnisse der Messung der Bereitschaft der TeilnehmerInnen für die Gruppe zu
kämpfen und zu sterben kann man in den folgenden Grafiken sehen.
Swann et al. (2009)
Abbildung 2 zeigt die Bereitschaft der TeilnehmerInnen für die Gruppe zu kämpfen. Wie
man sieht ist die Bereitschaft der fusionierten ("fused") Testpersonen tendenziell höher als
die der nicht-fusionierten ("nonfused"), da der Wert näher 0 ist. Außerdem ist zu sehen,
dass bei fusionierten Personen, die provozierte ("challenge") Gruppe eher bereit ist zu
kämpfen als die verifizierte ("verifiy"). Dies ist der Nachweis, dass bei Aktivierung der
persönlichen Identität, also bei einer Herbeiführung von Diskrepanz in der Persönlichkeit
von fusionierten Personen, sich dies direkt auf die Gruppenidentität auswirkt. Bei nicht-
Abbildung 2: Study 1: Willingess to fight for the group

!
!)$!
fusionierten Personen ist dies nämlich nicht der Fall, hier gibt es keinen Unterschied bei
provozierten und verifizierten TeilnehmerInnen, es wird nicht die Bereitschaft für die
Gruppe zu kämpfen beeinflusst.
Abbildung 3 zeigt einen ganz ähnlichen Sachverhalt, wenn es um die Bereitschaft für die
Gruppe zu sterben geht. Wiederum sind fusionierte Personen generell geneigter für die
Gruppe zu sterben als nicht-Fusionierte und wiederum sind die Fusionierten subjektiv
provozierten eher bereit zu sterben als die Fusionierten subjektiv verifizierten.
Swann et al. (2009)
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass:
1. Mit der Gruppe fusionierte Personen eine höhere Bereitschaft für diese zu kämpfen
(p<.002) und zu sterben (p<.001) hatten.
2. Fusionierte Personen eher bereit waren zu kämpfen (p<.003) und zu sterben (p<.008) bei
Provokation der persönlichen Identität als bei Verifizierung dieser. Bei den nicht-
fusionierten Personen gab es keinen Unterschied bei der Bereitschaft zu kämpfen (p=.65)
und zu sterben (p=.98), unabhängig davon ob sie provoziert oder verifiziert wurden.
Außerdem hat man erfahren, dass mit höherer Identifikation mit der Gruppe auch die
Bereitschaft steigt für diese zu kämpfen (p<.001) und zu sterben (p<.001), da Identifikation
einen größeren Einfluss auf fusionierte als auf nicht-fusionierte Personen hat. All diese
Messwerte sind signifikant.
Abbildung 3 : Study 1: Willingness to die for the group

!
!)%!
Aus diesen Ergebnissen hat man geschlussfolgert, dass die persönlichen und sozialen
Identitäten bei fusionierten Personen gleichberechtigt sind und sich gegenseitig
beeinflussen. Es herrscht eine Wechselwirkung vor. Allerdings hat man damit gerechnet,
dass Kritik bezüglich des/der Feedback-Evaluators/in ausgeübt werden könnte, da diese/r
ein Gruppenmitglied ist. Man könnte argumentieren, dass der/die TeilnehmerIn den
inneren Konsens der Gruppe in Frage stellt, wenn er/sie nicht-verifizierendes Feedback
von einem Gruppenmitglied bekommt, was dann die Ergebnisse verfälschen könnte. Er/sie
könnte aus Kompensationsgründen hohe Bereitschaft für die Gruppe zu kämpfen und zu
sterben angeben. Um diesen möglichen Vorwürfen vorzubeugen wurde ein zweites
Experiment durchgeführt, in dem das Feedback von einem Nicht-Gruppenmitglied kam.
2.6. Experiment 2
Das zweite Experiment stellt die Frage, ob eine Provokation der persönlichen Identität –
von einem Nicht-Gruppenmitglied ausgehend – extremes Pro-Gruppenverhalten verstärkt
bzw. hervorruft (im englischen Original: "Will a Challenge of a Personal Identity From an
Outgroup Member Increase Extreme Pro-Group Behavior?").
Das Studiendesign entspricht dem aus Experiment 1.
2.6.1. TeilnehmerInnen und Methode
Auch in diesem Fall waren die TeilnehmerInnen spanische Studierende, die für ihre
Teilnahme an den zwei Teilen der Onlinestudie Creditpoints bekamen. Es waren 326
TeilnehmerInnen, davon 278 weiblich und 48 männlich, mit einem Durchschnittsalter von
31,06 Jahren.
Der Ablauf des Experiments unterscheidet sich kaum von dem Ablauf in dem ersten
Versuch. Deshalb wird im Folgenden nur auf die Unterschiede zu Experiment 1
eingegangen, bevor dann die Ergebnisse präsentiert werden.
Im ersten Durchgang wurden die gleichen Daten erhoben wie in Experiment 1.
Fusionierung und Identifikation der TeilnehmerInnen mit Spanien, die Frage nach dem
Prototyp der Gruppe und die fünf negativen Persönlichkeitstraits inklusive der
Beispieltexte.
Im zweiten Durchgang jedoch wurde den TeilnehmerInnen gesagt, dass das (wiederum

!
!)&!
fingierte) Feedback von einem/r EvaluatorIn aus einem der anderen 26 EU-Länder kam –
nicht von einem aus Spanien. Es wurde allerdings nicht angegeben aus welchem. Zwecks
Glaubwürdigkeit wurden die TeilnehmerInnen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten in
Zukunft auch einmal die Rolle eines/r EvaluatorIn zu übernehmen. Außerdem mussten die
TeilnehmerInnen angeben aus welchem Ursprungsland der/die EvaluatorIn ihrer Meinung
nach stammt; sowie den Status, den dieses Landes im Vergleich zu Spanien ihrer Meinung
nach inne hat. Dabei wurden 23 von den 26 möglichen EU-Ländern genannt und keines
davon mit einer auffälligen Häufigkeit.
Der restliche Teil des zweiten Durchgangs war ident mit dem zweiten Durchgang in
Experiment 1.
2.6.2. Ergebnisse
Die Korrelation zwischen Identitätsidentifikation und Fusion war verhältnismäßig, bei der
Frage nach dem Prototypen der Gruppe und der Fusion mit der Gruppe bestand keine
Korrelation.
Der Manipulationscheck des Selbstbildes ergab, dass – bei der provozierten Gruppe im
Vergleich mit der verifizierten Gruppe – nicht der Fall vorlag, dass der die EvaluatorIn die
TeilnehmerInnen sah, wie sie sich selbst sahen. Dementsprechend waren die Daten
aussagekräftig.
Auch die Ergebnisse entsprachen denen von Experiment 1. Wiederum hatten fusionierte
Personen eine höhere Bereitschaft für die Gruppe zu kämpfen (p<.001) und zu sterben
(p<.001) als nicht-Fusionierte. Außerdem waren fusionierte Personen wiederum eher bereit
zu kämpfen (p<.001) und zu sterben (p<.001) bei Provokation der persönlichen Identität
als bei Verifizierung dieser. Bei den nicht-fusionierten Personen gab es keinen Unterschied
bei der Bereitschaft zu kämpfen (p=.93) und zu sterben (p=.94), unabhängig davon ob sie
provoziert oder verifiziert wurden. Dies kann man auch in Abbildung 4 (Study 2:
Willingness to fight for the group) und 5 ( Study 2: Willingness to die for the group) sehen;
diese gleichen ebenfalls den bisher gezeigten.

!
!)'!
Swann et al. (2009)
Swann et al. (2009)
Aus den Ergebnissen von Experiment kann man schlussfolgern, dass es keine Rolle spielt,
ob das provozierende Feedback von einem/r EvaluatorIn aus der Gruppe oder einem/r
Außenstehenden kommt. Der Effekt ist der gleiche und die Ergebnisse sind vergleichbar.
Nach wie vor gilt die Annahme, dass die soziale und die persönliche Identität gleichgestellt
sind. Dies führte dazu, dass – egal welche man aktiviert – die andere davon betroffen sein
sollte. Diese Überlegung bildete die Grundlage für Experiment 3.
Abbildung 4: Study 2: Willingness to fight for the group
Abbildung 5: Study 2: Willingness to die for the group

!
!)(!
2.7. Experiment 3
Das dritte Experiment stellt die Frage, ob bei einer fusionierten Person die Aktivierung der
persönlichen Identität die gleiche Wirkung hat wie die Aktivierung der Sozialen (im
englischen Original: "Is Activating the Personal Identities of Fused People Functionally
Equivalent to Activating Their Social Identities?").
Dieses Mal hat man ein 2x3-Faktoren Studiendesign gewählt. Die TeilnehmerInnen waren
fusioniert oder nicht-fusioniert und es wurde entweder die soziale, die persönliche oder
keine Identität (Kontrollgruppe) aktiviert.
2.7.1. TeilnehmerInnen und Methode
Die TeilnehmerInnen waren spanische SchülerInnen einer High School, die sich bereit
erklärten an einem psychologischen Experiment teilzunehmen. Es wurde auch das
Einverständnis der Eltern eingeholt. Insgesamt nahmen 421 Personen daran teil; davon 369
weiblich und 52 männlich mit einem Durchschnittsalter von 15,81 Jahren. Die Studie
bestand aus zwei Durchgängen, in denen Fragebögen zur Erhebung verwendet wurden.
Zwischen den Durchgängen lagen 10 Tage Abstand.
Der 1. Durchgang ist vergleichbar mit Experiment 1 und 2. Es wurden die Identifikation
und Fusion der TeilnehmerInnen mit Spanien erhoben, die Frage nach dem Prototyp der
Gruppe gestellt und die fünf Persönlichkeitstraits inklusive der Beispieltexte ermittelt.
Hinzu kam die Messung der Gewissheit die angegebenen Persönlichkeitsattribute (traits)
auch wirklich zu besitzen und wie stark sie zutreffen.
Im 2. Durchgang bekamen die TeilnehmerInnen fingiertes Feedback von einem/r
EvaluatorIn, dieses Mal hatten jedoch alle dieselbe Form. Jede Rückmeldung war "positiv"
provozierend, mit nur einer von fünf Übereinstimmungen bei den
Persönlichkeitsattributen. Da alle TeilnehmerInnen diese Art des Feedbacks bekamen,
stellte dieser Vorgang auch nicht die Manipulation dar, wie in den vorhergehenden
Experimenten. Die manipulierende Variable war die soziale oder persönliche
Identitätsaktivierung der TeilnehmerInnen (oder keine Aktivierung im Falle der
Kontrollgruppe). Dazu wurden sie zufällig einer der drei Gruppen zugeordnet. Bei der

!
!+*!
Aktivierung der sozialen Identität wurde den TeilnehmerInnen der Fragebogen zur
Messung der Bereitschaft für die Gruppe zu kämpfen vorgelegt. Bei Aktivierung der
persönlichen Identität wurde eine abgewandelte Version dieses Fragebogens herangezogen
in der die Fragen nicht auf die Gruppe, sondern auf den/die TeilnehmerIn selbst bezogen
wurden. Zum Beispiel: "I would fight someone phyiscally threatening me." Der
Kontrollgruppe wurde kein weiterer Fragebogen vorgelegt, es fand keine Aktivierung statt.
Im Anschluss daran folgte die eigentliche Messung des 3. Experiments. Hierzu wurde von
allen TeilnehmerInnen die Bereitschaft für die Gruppe zu sterben erhoben. Die Bereitschaft
für die Gruppe zu kämpfen wurde nicht mehr abgefragt, da dieser Fragebogen schon bei
der Manipulation verwendet wurde. Das letzte Messinstrument war nochmals die Messung
der Gewissheit die in Durchgang 1 angegebenen Persönlichkeitsattribute (traits) auch
wirklich zu besitzen und wie stark sie zutreffen. Man wollte wissen ob sich diese Werte
verändert haben, da die Theorie besagt, dass sich eine Identität – bei Fokussierung der
Aufmerksamkeit auf eben diese – festigt (Brinol, Petty, Gallardo,2007). Man hat dann
einen "Index der Gewissheit" erstellt, indem man die Messwerte aus dem 1.Durchgang von
denen aus dem 2.Durchgang subtrahiert hat.
2.7.2. Ergebnisse
Man kann in Abbildung 6 sehen, dass wieder die erwarteten Ergebnisse eingetreten sind.
Fusionierte Personen besitzen eine tendenziell höhere Bereitschaft für die Gruppe zu
sterben (p<.001) als nicht Fusionierte. Außerdem waren bei den fusionierten
TeilnehmerInnen beide Experimentalgruppen – sowohl die persönlich, als auch die sozial
aktivierte – eher bereit für die Gruppe zu sterben (p<.05) als solche, die sich in der
Kontrollgruppe befanden. Bei den nicht-fusionierten Personen gab es diesen Unterschied
zwischen Kontrollgruppe und persönlich aktivierter Gruppe nicht. Dies spricht für die
Theorie, dass bei fusionierten Personen, sowohl die Aktivierung der persönlichen als auch
der sozialen Identität den gleichen Effekt haben. Interessant ist zu sehen, dass die
Aktivierung der sozialen Identität von nicht-fusionierten Personen ihre Bereitschaft für die
Gruppe zu sterben auf ein Level, ähnlich dem der Kontrollgruppe der fusionierten
Personen, hebt.

!
!+)!
Swann et al. (2009)
Abbildung 7 zeigt, ob die Aktivierung der sozialen bzw. persönlichen Identität der
fusionierten TeilnehmerInnen die Gewissheit ihres persönlichen Selbst festigt. Es wurde
erwartet, dass bei fusionierten Personen, sowohl die sozial als auch die persönlich
Aktivierten, hohe Werte in der Gewissheit ihrer persönlichen Identität aufweisen würden.
Bei nicht-Fusionierten sollte dies nur bei den persönlich Aktivierten der Fall sein. Die
Ergebnisse bestätigen die Erwartungen. Die beiden fusionierten Experimentalgruppen
wiesen höhere Werte bei der Gewissheit ihrer persönlichen Identität auf (p<.001) als die
Kontrollgruppe. Zwischen den beiden Experimentalgruppen gab es jedoch keinen großen
Unterschied (p=.20).
Bei den nicht-fusionierten Personen hatten die Personen mit persönlich aktivierten
Identitäten höhere Messwerte (p<.001) als die in den beiden anderen Gruppen. Es gab
keinen nennenswerten Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und den sozial aktivierten
TeilnehmerInnen.
Abbildung 6: Study 3: Willingness to die for the group

!
!++!
Swann et al. (2009)
Aus den Ergebnissen resultiert, dass die persönlichen und sozialen Identitäten von
fusionierten Personen funktional äquivalent sind. Unabhängig davon welche man aktiviert
steigt:
1. Die Bereitschaft für die Gruppe zu sterben
2. Die Gewissheit der subjektiven Persönlichkeitsattribute der TeilnehmerInnen.
2.8. Diskussion
Die Erwartungen und theoretischen Annahmen von Swann et al. konnten durch die
Experimente bestätigt werden.
Sie heben heraus, dass abgesehen von Michael Hogg, der sich mit dem Zusammenhang
von sozialer Identität und extremen Gruppenverhalten beschäftigt (Uncertainty-identity
Theory, 2007) diese Studie die Erste ist, welche sich mit dem Verhältnis von persönlicher
und sozialer Identität und extremen Verhalten auseinander setzt.
Da dies erst der Anfang der Untersuchung der Identitäts-Fusion ist, geben sie den Rat an
zukünftige Forschung, sich mit den Effekten auseinander zu setzten, welche den
Manipulationen in den Experimenten zu Grunde liegen könnten.
Abschließend ist zu sagen, dass jene Studien-TeilnehmerInnen nun nicht gleich als
Terroristen identifiziert werden können. Swann et al. geben jedoch an, dass unter
bestimmten Bedingungen es wahrscheinlicher ist, dass fusionierte Personen sich extremen
Abbildung 7: Study 3: Certainty of personal Identities

!
!+"!
politischen Parteien anschließen, eher militärische Einsätze befürworten würden oder auch
in extremistischen Gruppen aktiv werden würden.
Swann et al. hoffen zudem mit Hilfe dieser Studie und dem Konzept der Identitäts-Fusion
einen weiteren Beitrag zur Debatte über das Zusammenspiel von persönlicher und sozialer
Identität liefern zu können. Ihnen ist es wichtig zu verdeutlichen, dass beide Identitäten
einen hohen Stellenwert haben und der Fokus eher darauf liegen sollte, das interaktive
Zusammenspiel dieser beiden zu erforschen.
Somit wurde in diesem Artikel eine neue Antwort auf die Frage, wieso Menschen für eine
Gruppe extreme Handlungen ausführen würden, gegeben und ein dazu gehöriges neues,
theoretisches Konzept vorgestellt.
3. Zusatztext 1: Identity Fusion and Self-Sacrifice: Arousal as a Catalist
of Pro-Group-Fighting, Dying and Helping Behavior (Swann, Gomez,
Huici, Morales & Hixon 2010)
Die der Studie zugrundeliegende Hypothese ist, dass die Erregung des vegetativen
Nervensystems bei Versuchspersonen, deren persönliche und soziale Identitäten fusioniert
sind, die Neigung extremes Verhalten zugunsten der Gruppe zu zeigen steigert. Da
fusionierte TeilnehmerInnen bereit sind, für die Gruppe zu handeln, sollte jede
Manipulation, die diese Bereitschaft erhöht, auch das Pro-Gruppen-Verhalten stärken.
Bereits frühe Studien haben gezeigt, dass die Erregung des sympathischen Nervensystems
eine Möglichkeit hierzu ist, beispielsweise wies Hull (1943) in Tierstudien einen
Zusammenhang zwischen der Erregung des sympathischen Nervensystems und der
Tendenz prädisponiertes Verhalten zu zeigen nach. Zudem legt die exitation-transfer-
theory (Zillmann, 1971) nahe, dass Erregung spätere emotionale Zustände beeinflusst.
Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden zwei Vorstudien sowie vier Experimente
durchgeführt, von denen im Folgenden eines genauer beschrieben wird.

!
!+#!
3.1. Experiment
Das erste Experiment geht der Frage nach, ob eine Erhöhung des Erregungszustands durch
das Spielen einer Art Völkerball („dodgeball“) die Bereitschaft für extremes Verhalten
zugunsten der Gruppe verstärkt. Das Studiendesign war ein 2x2 Faktorenmodell (fusioniert
vs. Nicht-fusioniert und Kontrollbedingung vs. Versuchsbedingung).
3.2. Teilnehmer/innen und Methode
Die 254 Versuchspersonen waren spanische MittelschülerInnen, sie nahmen an dem
Experiment als Teil des Sportunterrichts teil. 99 von ihnen waren Mädchen und 155
Jungen, ihr durchschnittliches Alter betrug 15.43 Jahre, die Standabweichung .97 Jahre.
Das Experiment bestand aus zwei Phasen, vor Beginn wurden die TeilnehmerInnen
informiert, dass sie an einer Untersuchung der Beziehung zwischen der Erregung des
autonomen Nervensystems und einer emotionalen Reaktion teilnahmen. Die
Versuchspersonen wurden zufällig der Kontroll- oder Versuchsgruppe zugeordnet.
In der ersten Phase wurde zunächst mit einer Pulsuhr die Herzschlagrate (als Maß der
Erregung) gemessen, anschließend komplettierten die Versuchspersonen den
Identitätsfusionstest und Mael und Ashforth's (1992) Identifikationsskala bezogen auf
Spanien. Die Kontrollgruppe fuhr direkt mit Phase Zwei fort, die Versuchsgruppe spielte
zunächst fünf Minuten ein auf Völkerball basierendes Spiel zwecks Manipulation ihres
Erregungszustands und fuhr dann mit Phase Zwei fort.
Phase Zwei begann mit einer erneuten Messung des Pulses um den Effekt der
Manipulation nachzuweisen, danach wurde abschließend die Bereitschaft zu extremen
Verhalten für die Gruppe mittels eines hierfür entwickelten sieben Items enthaltenden
sieben-stufigen Likert-Skala gemessen.
3.3. Ergebnisse
Die Messung der Identitätsfusion ergab, dass bei 32.7% der Versuchspersonen die
persönliche Identität mit der der Gruppe Spanien fusioniert ist. Die Korrelation zwischen
Fusion und Identifikation war gering.
Der Effekt der Manipulation war wie erwartet, die Versuchsgruppe wies bei der zweiten

!
!+$!
Messung der Herzschlagrate zu Beginn von Phase Zwei ein signifikant höheres Maß an
Erregung auf als bei der ersten Messung und auch als die Kontrollgruppe, deren
Erregungszustand konstant blieb.
Die Messung der Bereitschaft zu extremen Pro-Gruppenverhalten ergab die in folgender
Grafik abgebildeten Ergebnisse.
Swann et al. (2010)
Abbildung 8 zeigt die Bereitschaft der TeilnehmerInnen extremes Verhalten zugunsten der
Gruppe Spanien zu zeigen. Grundsätzlich ist die Bereitschaft hierzu bei fusionierten
Versuchspersonen („fused“) größer. Zudem wird erkennbar, dass die fusionierten
Versuchspersonen in der manipulierten Bedingung („arousal“) im Gegensatz zu den
fusionierten der Kontrollgruppe („control“) eine erheblich größere Bereitschaft zu
extremen Pro-Gruppenverhalten aufweisen. Weiterhin ergibt sich bei nicht fusionierten
TeilnehmerInnen („nonfused“) zwischen Kontroll- und Versuchsgruppe kein signifikanter
Unterschied in der Bereitschaft zu extremen Verhalten für die Gruppe.
Eine stufenweise multiple Regressionsanalyse ergab zudem, dass der Pulswert der zweiten
Messung als Prädiktor für extremes Verhalten bei fusionierten Versuchspersonen fungiert
(B= 0.78, t(240)= 4.37,p< .001), bei den nicht-fusionierten TeilnehmerInnen jedoch nicht
(B= 0.14, t(240)= 1.11, p>.25). Eine Interaktion zwischen Identifikation und
physiologischer Erregung konnte nicht nachgewiesen werden, jedoch konnte die
!"##$%&'()!*+!,-'&$./+!0.1.$-23456-!7'!.8-1.9.(!:1;<=1'>>.(?.145%-.(!
n

!
!+%!
vorhergesagte Interaktion zwischen Fusion und Erregung aufgezeigt werden (B= 0.30,
t(237)= 3.70, p < .001).
3.4. Diskussion
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Manipulation des Erregungszustands
bei fusionierten TeilnehmerInnen die Bereitschaft zu extremem Pro-Gruppenverhalten
verstärkt. Da Fusion im Gegensatz zu Identifikation mit Erregung interagiert, wird erneut
angedeutet, dass sie sich grundlegend vom Konstrukt Identifikation unterscheidet und in
besonderer Weise die Wahrscheinlichkeit extremen Verhaltens zugunsten der Gruppe
vorherzusagen vermag.
Die AutorInnen nehmen jedoch an, dass sich eventuell der Gruppencharakter des zur
Manipulation des Erregungszustands verwendeten Spiels ebenso wie die Gegenwart von
anderen TeilnehmerInnen verzerrend auf die Ergebnisse ausgewirkt haben könnte.
Außerdem könnte ein Wir-gegen-Sie Gefühl der beim Völkerball gegeneinander
angetretenen Teams die Ergebnisse der Manipulation verfälscht haben.
Die Ergebnisse des zweiten Experiments, in dem die physiologische Erregung durch eine
individuelle Methode (Einzelsprint) verändert wurde, zeigen allerdings ähnliche
Ergebnisse bezogen auf den Zusammenhang von Erregungszustand, Fusion und der
Bereitschaft extremes Pro-Gruppenverhalten zu zeigen, sodass diese Einwände abgewiesen
werden können.
Abschließend kann also festgestellt werden, dass diese Studie die Ergebnisse des
Hauptartikels bestätigt und darüber hinaus gehend der physiologische Erregungszustand
eine wichtige Rolle bei der Vorhersage extremen Verhaltens spielt.
4. Zusatztext 2: On the Nature of Identity Fusion: Insights Into the
Construct and a New Measure (Swann, Gomez, Brooks, Buhrmeister,
Vazquez & Jetten, 2011)
Der Artikel handelt von der Weiterentwicklung der Fusions-Theorie. Es soll die Frage

!
!+&!
geklärt werden, wie Fusion mit einer Gruppe zustande kommt, wie sich diese äußert und
wieso fusionierte Personen zu extremen Handlungen, die dem Wohl der Gruppe dienen,
bereit sind.
Spezifischer ausgedrückt will man etwas über die Natur der Fusion herausfinden und
inwieweit sie sich von anderen sozialpsychologischen Modellen, wie der
Identifikationstheorie, abgrenzt. Außerdem wurde untersucht welche anderen
Mechanismen bei der Fusion eine wichtige Rolle spielen und die möglichen extremen
Handlungen der fusionierten Gruppenmitglieder beeinflussen.
Um dies herauszufinden wurde eine neue Messmethode für Fusion entwickelt, die sich von
der bisher bekannten bildlichen Methode unterscheidet.
4.1. Theorie
Die Theorie von Brewer und Gardner (1996) besagt, dass es zwei verschiedene Arten der
Gruppenbildung bzw. Gruppenzugehörigkeit gibt. Da wären der relationale ("relational")
und der kollektiv-gemeinschaftliche ("collective") Zugang.
Bei Erstgenanntem kann man die Gruppe als eine Art "Familie" sehen, man kennt die
Mitglieder und hat oft ein persönliches Verhältnis zu ihnen; sie sind nicht einfach
ersetzbar, sondern – überspitzt ausgedrückt – einzigartige Individuen. Diese Form der
Gruppenzugehörigkeit kommt oft in östlichen Kulturen, zum Beispiel in Japan vor.
Beim kollektiv-gemeinschaftlichen Zugang liegt der Schwerpunkt für das Mitglied auf der
Idee und dem Verständnis der Gruppe. Einzelne Mitglieder ähneln sich untereinander und
sind auch austauschbar; man muss sie nicht kennen. Was zählt sind die Gemeinsamkeiten,
zum Beispiel gleiche Interessen, die man in der Gruppe findet. Diese Art von
Gruppenzugehörigkeit ist typisch für westliche Kulturen.
Swann et al (2011) schlussfolgern daraus, dass bei einer Fusion eher die relationale
Bindung zu der Gruppe im Vordergrund steht, während bei der Identifikationstheorie die
kollektiv-gemeinschaftliche Bindung eine wichtigere Rolle spielt. Wenn fusionierte
Personen sich mit den Mitgliedern ihrer Gruppe relational vereinigt fühlen und sie fast
schon als "Familie" betrachten führt das dazu, dass sie eine tiefe Verbundenheit
("connectedness") mit der Gruppe empfinden. Diese Verbundenheit zum einen und die
wechselseitige Stärke ("reciprocal strength"), welche in der Gruppe entsteht, zum anderen
bilden die Grundlage für das neue Messinstrument der Fusion. Wechselseitige Stärke
deshalb, weil man alles daran setzt und dafür tun würde, dass es den anderen Mitgliedern

!
!+'!
gut geht und davon ausgegangen wird, dass diese genauso handeln und einen selbst
beschützen würden. Bei der Identifikationstheorie kommt so ein Verhältnis nicht zu
Stande, da bei einem kollektiv-gemeinschaftlichen Gruppenzugang der Einzelne nicht so
eine wichtige Rolle inne hat, sondern austauschbar ist und leichter durch eine andere
Person ersetzt werden kann.
Weiterhin wollte man wissen welche Mechanismen eine Rolle spielen, wenn fusionierte
Personen sich zu extremen und gefährlichen Handlungen hinreißen lassen um ihre
Gruppenmitglieder zu beschützen. Aufgrund der tiefen Verbundenheit mit der Gruppe und
der wechselseitigen Stärke sind Swann et al. (2011) der Meinung, dass fusionierte
Personen auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gruppe und deren Mitglieder
verspüren. Diese gefühlte Verantwortung führt dazu, dass man die Gruppe beschützen will,
erklärt aber noch nicht wieso man sich so bereitwillig gefährlichen Situationen aussetzt
und sein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Deshalb kommt neben dem Mechanismus der
"Verantwortung" noch der Faktor einer gefühlten "Unverwundbarkeit" zum Tragen.
Basierend auf der wechselseitigen Stärke fühlen sich fusionierte Mitglieder einer Gruppe
unantastbarer bzw. unverwundbarer als Individuen, die dieser Gruppe nicht angehören. Es
wurde getestet, ob diese beiden Mechanismen wirklich eine Rolle bei der Fusion eines
Individuums mit einer Gruppe spielen.
4.2. Studien
Insgesamt wurden im Lauf der Studie 10 Experimente durchgeführt, die im Folgenden
zusammengefasst vorgestellt werden.
Die Experimente 1 und 2 dienten dazu die neue Messmethode für Fusion, basierend auf
Verbundenheit ("connectedness") und wechselseitige Stärke ("reciprocal strength"), zu
generieren. Das neue Verfahren war kein bildliches, wie das bisher bekannte, sondern ein
verbales. Auch bestand es nicht mehr aus nur einem Item, sondern – da mehr Items auch
für mehr Zuverlässigkeit sprechen als nur eines – zunächst aus 13. Diese 13 Items wurden
dann sowohl Spaniern als auch Amerikanern vorgelegt und die Irreführenden wurden
gestrichen. Übrig blieben 11 Items, welche wiederum über einen längeren Zeitraum
getestet wurden. Nach der statistischen Auswertung mittels Faktorenanalyse blieben noch
7 Items übrig. Diese 7 Items, von denen man jedes auf einer Skala von 0 ("strongly

!
!+(!
disagree") bis 6 ("strongly agree") bewerten konnte, bildeten die neue Messmethode für
Fusion, die sogenannte "Verbal Fusion Scale" (siehe Abbildung 9).
Swann et al. (2011)
Die Experimente 3 und 4 hatten die Aufgabe die diskriminante Validität der neuen
Messmethode zu überprüfen, also die Frage, ob sie etwas misst, was sie nicht soll bzw. was
andere Messmethoden bereits erheben. Dazu wurde sie zuerst mit der
Identifikationsmessung verglichen. Es kam allerdings heraus, dass die beiden Modelle auf
unterschiedliche Faktoren laden und deshalb die Fusionsmessmethode und die
Identifikationsmessmethode unterschiedliche Werte messen, und deshalb – auch wenn sie
miteinander verwandt – doch großteils unabhängig voneinander sind (Abbildung 10)
Des weiteren wurde die "Verbal Fusion Scale" noch mit sieben anderen Skalen verglichen,
von denen aber nur die bereits genannten, gefühlte Verantwortung ("feelings of agency")
und Unverwundbarkeit ("invulnerabilty"), eine Konvergenz aufzeigten.
Abbildung 9: Verbal Fusion Scale

!
!"*!
Die Experimente 5-8 überprüften die Qualität der neuen Messmethode extremes
Gruppenverhalten vorherzusagen im Vergleich zu der bisher bekannten bildlichen
Messmethode und der Identifikationsmessung. Experiment 5 bestätigte hierbei, dass die
"Verbal Fusion Scale" besser dazu geeignet war eine Langzeitprognose (6 Monate) der
Bereitschaft für die Gruppe zu kämpfen bzw. zu sterben geben konnte als dies die
Identifikationsmessung zuließ. Es gab jedoch keinen Unterschied bei der Zuverlässigkeit
zwischen der bildlichen und der verbalen Fusions-Messmethode.
Swann et al. (2011)
Experiment 6 bediente sich des sogenannten "Trolley-Dilemmas", der Frage ob
Versuchspersonen von einer Brücke springen und sich vor eine Straßenbahn werfen - und
sich somit selbst opfern würden - um Gruppenmitglieder zu retten.
Die verbale Fusionsmessmethode war die zuverlässigste, auch zuverlässiger als die
Bildliche. Diese jedoch war immer noch konkreter als die Identifikationsmessung.
In Experiment 7 wurden nicht spanische Staatsbürger, sondern ImmigrantInnen befragt, die
sich bereits zwischen 3 und 5 Jahren in Spanien aufgehalten haben. Die Bereitschaft für ihr
Ursprungsland extremes Gruppenverhalten zu zeigen wurde wiederum von der verbalen
Fusionsmessmethode am besten vorhergesagt. Ähnlich verhielt es sich in Experiment 8 bei
dem die TeilnehmerInnen alle AmerikanerInnen waren.
Experiment 9 und 10 hatten die Aufgabe die nomologische Validität des neuen
Abbildung 10: Faktorenanalyse Fusion & Identifikation

!
!")!
Messverfahrens zu überprüfen. Bei Experiment 9 wurden Mediatorvariablen bezüglich
"Gefühlter Verantwortung" und "Unverwundbarkeit" herangezogen und es wurde
überprüft, ob sie die neue verbale Messmethode beeinflussen. Dazu wurde wieder eine
Umfrage mit spanischen TeilnehmerInnen durchgeführt. Zuerst wurden die beiden
Fusions- und der Identifikationszustand erhoben, dann die Mediatorvariablen "Gefühlte
Verantwortung" und "Unverwundbarkeit" und zuletzt die Bereitschaft für extremes
Gruppenverhalten (Bereitschaft für die Gruppe zu kämpfen und zu sterben). Es wurde
festgestellt, dass die beiden Mediatorvariablen einen enormen Einfluss auf die Fusion
haben. Bei der bildlichen Fusionsmessung waren sie beide signifikant und hatten einen
Teileinfluss auf die Aussagekraft der Messung. Bei der verbalen Fusionsmessung hatten
sie jedoch einen so großen Einfluss, dass, wenn man beide in die Gleichung mit
eingerechnet hat, der Effekt der verbalen Fusion alleine nicht mehr signifikant war.
Dementsprechend spielen "Gefühlte Verantwortung" und "Unverwundbarkeit" eine große
Rolle bei dem Thema Fusion.
Experiment 10 ist vergleichbar mit den Studien, die man bereits aus Identity Fusion: The
Interplay of Personal and Social Identities in Extreme Group Behavior (Swan et al., 2009)
kennt. Es wurde ein leicht abgewandelter Versuch der darin vorkommenden Experimente
durchgeführt, welcher die neue, verbale Fusionsmessmethode enthält. Die Ergebnisse
waren mit den Bisherigen vergleichbar, Fusion – egal ob bildlich oder verbal gemessen –
ist ein guter Indikator für extremes Pro-Gruppen Verhalten. Menschen mit hohen
Fusionswerten sind eher geneigt für ihre Gruppenmitglieder zu kämpfen und zu sterben als
Solche mit niedrigen Fusionswerten.
4.3. Ergebnisse
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die neue verbale Messmethode der Fusion die
Alte übertrifft, da sie mit 7 Items ein zuverlässigeres Messinstrument darstellt und das
Ergebnis nicht dichotom sondern stetig ist. Man kann nicht mehr nur fusioniert oder nicht-
fusioniert sein, sondern skalenweise sehr schwach bis sehr stark fusioniert sein. Auch sagt
sie die Bereitschaft für extremes Pro-Gruppen-Verhalten in vielen Fällen zuverlässiger aus
als die bildliche Messmethode und viel zuverlässiger als es die Identifikation einer Person
mit einer Gruppe kann. Dadurch ist auch bewiesen, dass Fusion und Identifikation zwei
unterschiedliche Modelle sind, die auf unterschiedliche Faktoren laden und sich nur
bedingt ähneln.

!
!"+!
Weiterhin wurde gezeigt, dass Fusion auf Verbundenheit und wechselseitiger Stärke
basiert und sowohl die Faktoren "gefühlte Verantwortung" und das Gefühl von
"Unverwundbarkeit" einen großen Einfluss haben. Es bleiben trotzdem Fragen offen, unter
anderem ob nicht noch andere Mechanismen neben Verbundenheit und wechselseitiger
Stärke eine wichtige Rolle bei der Fusion spielen. Weiters sollte man auch den Einfluss
den die unterschiedlichen Kulturen auf die Fusion haben untersuchen.
5. Zusatztext 3: When Group Membership Gets Personal: A Theory of
Identity Fusion (2012)
Der folgende Teil der Arbeit bezieht sich auf den Artikel When Group Membership Gets
Personal: A Theory of Identity Fusion (2012). Dieser ist die jüngste Veröffentlichung zum
Thema Identity-Fusion von Swann und seinen Kollegen. Er wurde 2012 im Psychological
Review veröffentlicht.
Dieser Artikel setzt es sich vor allem zum Ziel noch einmal die Entwicklung der Identitäts-
Fusion und den bisherigen Lauf der Forschung nachzuzeichnen.
Neu an diesem Artikel ist, dass nun auch auf Gründe für die Identitäts-Fusion eingegangen
wird, sowie diese durch 4 Prinzipien neu charakterisiert wird und auch kulturelle
Unterschiede angegeben werden.
Wie schon erwähnt, tritt eine Identitäts-Fusion auf, wenn Menschen ein besonderes Gefühl
der Einheit und Verbundenheit mit einer Gruppe erleben. Auf Grund dieser hohen
Verbundenheit ist die Trennlinie zwischen persönlichem und sozialem Selbst sehr
durchlässig. (Fusionierte Personen sehen sich dadurch aus beiden Perspektiven, der der
sozialen Identität: „My group membership is a crucial part of who I am.“ und der
persönlichen: „I am an important part of my group.“)
Wie schon erläutert, lässt genau diese Verschmelzung Menschen genau so viel für sich
selbst, wie für ihre Gruppe tun. Weitere Folgen sind eine hohe Verbundenheit mit der
jeweiligen Gruppe und sehr starke Bindungen zu anderen Mitgliedern.
Fusionierte Personen verfügen über ein hohes Verantwortungsgefühl für die Gruppe und
deren Mitglieder. Sie ordnen dieses Gefühl nicht nur sich selbst zu, sondern auch anderen.

!
!""!
Sie gehen davon aus, dass alle übrigen Gruppenmitglieder eine genau so hohe
Verantwortung verspüren und schließen daraus, dass diese genau so wie sie handeln
würden.
Daraus folgt, dass fusionierte Personen das Gefühl haben, dass die Gruppe als ganzes nicht
nur extrem stark ist, sondern auch unverwundbar.
In diesem Artikel wurde nicht nur die Einschätzung der Gruppenmitglieder herausgehoben,
es wurden auch vier Prinzipien vorgestellt, die die Identitäts-Fusion charakterisieren und
diese von anderen Verbundenheitskonzepten (z.B.: Identifikation) abgrenzen.
5.1. Vier Prinzipien der Identity Fusion
Agentic-Personal-Self-Principle
Dieses Prinzip dient als wichtige Unterscheidung zwischen Identitäts-Fusion und
Identifikation. Nach der Social Identity Theory würde bei einer Person, die sich voll und
ganz mit der Gruppe identifiziert, eine Depersonalisation stattfinden. Die soziale Identität
würde gestärkt und die persönliche geschwächt werden. Des Weiteren würde das eigene
Verantwortungsgefühl keine große Rolle mehr spielen, wichtig wäre die Verantwortung
dieser Personen gegenüber der Gruppe.
Dies ist bei fusionierten Personen nicht der Fall, beide Identitäten bleiben salient und stark.
Ihre Handlungen spiegeln also beide Identitäten wieder. Zudem wird das
Verantwortungsgefühl für die Person selbst mit dem für die Gruppe gleich gesetzt. (Swann
et. al, 2010)
Identity Synergy Principle
Dieses Prinzip bezieht sich auf die erste Studie zur Identitäts-Fusion und beschreibt das
Zusammenwirken von Identitäten bei fusionierten Personen. So konnte zum Beispiel in
einer früheren Studie gezeigt werden, dass es keinen Unterschied macht, welche Identität
der fusionierten Personen aktiviert wird. Beide Fälle führen zu Gruppen befürwortenden
Verhalten. (Swann et al., 2009)
Durch dieses Zusammenwirken und die Gleichstellung der Identitäten sind solche
Personen eher geneigt extremes und besonderes Pro-Gruppen-Verhalten auszuführen.
Relational Ties Principle
Dieses Prinzip wurde 2010 mit Hilfe des Trolley Dilemmas bestätigt und befasst sich mit

!
!"#!
der hohen Bindung, die fusionierte Personen zu ihren Gruppenmitgliedern verspüren
(Swann et al., 2010). Sie sehen nicht nur sich selbst als einen besonderen Teil der Gruppe,
sondern auch die anderen. Sie schätzen diese auf Grund ihrer Mitgliedschaft, aber auch
wegen ihrer einzigartigen Persönlichkeit.
Dieses Prinzip wirkt jedoch unterschiedlich, je nachdem, ob eine lokale („local“) oder eine
ausgedehnte („extended“) Fusion vorherrscht. Bei einer lokalen Fusion beziehen
fusionierte Personen ihre starke Bindung auf Menschen mit denen sie Kontakt haben und
welche sie auch persönlich kennen.
Handelt es sich um eine ausgedehnte Fusion, wie zum Beispiel mit dem Land Spanien, so
fühlen sich fusionierte Personen verbunden mit einer sehr großen Gruppe an Menschen,
die sie vielleicht gar nicht kennen.
Irrevocability Principle
Das Irrevocability Principle bezieht sich auf die Dauer und die Beständigkeit der Fusion.
Wenn Menschen einmal fusioniert mit einer Gruppe sind, sollte sie dies auch bleiben. Dies
hängt vor allem mit der hohen Bindung zur Gruppe und deren Mitglieder zusammen. Da
einige Versuchspersonen zu mehreren Zeitpunkten getestet wurden und sich die Werte
ihrer Fusion nicht geändert haben, gilt auch dieses Prinzip als bestätigt.
1.1. Gründe für eine Identitäts-Fusion
Swann et al. beschreiben zwei wichtige Sichtweisen zur Begründung der Identitäts-Fusion,
zum einen eine evolutionstheoretische Perspektive, zum anderen stellen sie sich die Frage
welche kulturellen Unterschiede es geben könnte.
Aus evolutionstheoretischer Sicht gab es schon immer Schwierigkeiten altruistisches
Verhalten beziehungsweise die Tatsche, dass Menschen sich selbst für andere opfern
würden, zu erklären.
Erst als Hamilton (1964) das Konzept der „inklusiven Fitness“ einführte, konnte jenes
Verhalten annähernd erklärt werden.
Das Prinzip der Inklusiven Fitness dehnt den Fitness-Begriff aus. Es besagt, dass wir uns
für das Überleben unserer Verwandten einsetzen, weil wir die selben Gene besitzen und so
auch die Wahrscheinlichkeit erhöht werden würde, dass diese geteilten Gene überleben
werden.

!
!"$!
Ganz im Sinne der Evolutionstheorie werden nur Verhaltensweisen übernommen, welche
auch das Überleben der Gene sichern können. Es macht jedoch keinen Unterschied ob die
Gene einer Person überleben indem sie selbst Nachkommen produziert, oder ob diese
Person ihren Geschwistern, welche auch zur Hälfte die selben Gene besitzen, hilft ihre
Kinder aufzuziehen.
Hamilton konnte rechnerisch zeigen, dass nicht nur unser Überleben, sondern auch das
unserer Verwandten evolutionstheoretisch wichtig sein kann. (David M. Buss, 2004, S.36
ff.)
Dies genügt für die Erklärung einer lokalen Fusion, da sich die Personen in solchen
Gruppen so fühlen „als-ob“ sie verwandt werden. Für die ausgedehnte Fusion reicht das
jedoch nicht aus. Da zwischenmenschliches Leben jedoch früher in Stämmen organisiert
war, könnte es sein, dass Fusion sich damals als wichtig erwiesen hat.
Es könnte also angenommen werden, dass die Fusion beziehungsweise die Möglichkeit
sich selbst für andere zu opfern als Nebenprodukt anderer wichtiger
Überlebensmechanismen entstanden ist.
Eine weitere Erklärung für die Fusion kann im kulturellen Umfeld gefunden werden.
Swann et al. betiteln diese als Fusion-freundliche Ideologien.
Eine mögliche Tradition die Fusions-Gefühle fördern könnte wäre zum Beispiel die
Anwendung des Jus Sanguinis (auch Abstammungsprinzip; Die Staatsbürgerschaft eines
Landes bekommt man, wenn die Eltern auch diese Staatsbürgerschaft besitzen) bei der
Vergabe der Staatsbürgerschaft. Die AutorInnen gehen davon aus, dass man in diesen
Ländern (z.B.: Österreich, Deutschland) eher zu einer Identitäts-Fusion neigt.
Ein weiteres Beispiel ist der Ubuntu Stamm, deren Mitglieder sich darüber definieren, dass
sie miteinander leben. Die Verbundenheit mit den anderen wird also zum zentralen
Merkmal der Identität. Swann et al. zitieren hier: „I am what I am because of who we all
are.“ (Leymah Gbowee)
Zudem gibt es auch andere Kulturen in denen mit Hilfe von Labels ein verstärktes Gefühl
der Zusammengehörigkeit erzeugt wird. Beispiele dafür lassen sich in der Sowjet-Union
finden, wo alle StaatsbürgerInnen als Brüder und Schwestern bezeichnet wurden.
Wie anhand weniger Beispiele zu sehen ist, gibt es große Unterschiede in der Art der
Bindung zur eigenen Kultur. In einer noch unveröffentlichten Studie erforschen Jetten,
Swann et al. wie hoch Fusion in unterschiedlichen Kontinenten ausfällt. Im vorliegenden
Artikel bemerken sie, dass zum Beispiel in China eine sehr hohe Fusionsrate (75%) unter

!
!"%!
Studierenden vorliegt. In Australien (10%) und den USA (25%) ist diese deutlich geringer.
(Sie belegen diese Daten an Hand eines noch unveröffentlichten Artikels: Patterns of
identity fusion in five continents. Jettenm Gómez, Buhrmester, Brooks, & Swann, 2012)
Kulturelle Ideologien können also nicht nur das Gefühl einer Fusion hervorrufen, sie
können auch bestimmen in welcher Art und Weise die Identitäts-Fusion ausgedrückt wird.
1.2. De-Fusion
Eine De-Fusion ist unwahrscheinlich, jedoch nicht unmöglich. Wie das Irrevability
Principle besagt und an dieser Stelle noch einmal an Hand des Films „Hurt Locker“
illustriert wird, bleiben die meisten Menschen über einen längeren Zeitraum fusioniert. Es
kann jedoch unter bestimmten Umständen vorkommen, wie zum Beispiel einem Bruch mit
bestimmten Personen aus der Gruppe oder der fundamentalen Veränderung der Gruppe
selbst.
Da jedoch eine große Umstellung, sowie ein Neuaufbau des Selbstverständnis durch eine
De-Fusion folgen würde, bleiben die meisten fusionierten Menschen so lange wie möglich
fusioniert.
5. 4. Fusion – Gut oder Böse?
Swann et al. empfinden die Identitäts-Fusion als ein sehr interessantes Thema, dies beruht
jedoch eher auf den negativen und extremen Konsequenzen, die eine Identitäts-Fusion mit
sich bringen kann.
Ihnen ist jedoch klar, dass es zu einfach wäre die Identitäts-Fusion als nur gut oder nur
schlecht zu kategorisieren. Viel mehr kann sie sozial angesehenes, wie auch anti-soziales
Verhalten bestärken. Egal um welche Gruppe es sich handelt, eine Person, die eine
fusionierte Identität mit sich bringt, wird diese Gruppe stärken und unterstützen.
Die Fusion kann nicht nur eine positive Auswirkung auf die Gruppe haben, sondern ebenso
bestärkend für das Individuum sein. Die Fusion ist eine Möglichkeit viele verschiedene
Bedürfnisse eines Menschen auf einmal zu befriedigen. Des weiteren geben Swann et al.
hier an, dass Fusion Menschen einen Sinn ihrer Existenz, so wie eine hohe Lebensqualität
vermitteln kann.

!
!"&!
Abschließend ist zu sagen, dass auch in diesem Artikel neue Erkenntnisse zum
ursprünglichen Konzept der Identitäts-Fusion beigetragen wurden. Die Erforschung dieser
ist jedoch noch lange nicht zu Ende. Gerade in diesem Artikel wurden einige neue
theoretische Abgrenzungen vollzogen, sowie kulturelle Unterschiede und
Entstehungsgründe aufgezeigt, welche erst durch weitere Studien bestätigt werden müssen.
2. Verbindung
Die Verbindung zwischen dem Hauptartikel und den von uns gewählten drei weiteren
Artikel ist die Weiterentwicklung und Spezifizierung des allgemeinen Themas der
Identitäts-Fusion.
Der Hauptartikel liefert das Grundkonzept, die drei weiteren Artikel vertiefen das Thema
hinsichtlich der Messung, der Differenzierung des Konzeptes, der Begründung des
Verhaltens und ganz allgemein der Natur der Fusion. Der erste Artikel untersucht genauer wie der Erregungszustand auf die Bereitschaft
extremes Pro-Gruppen-Verhalten auszuführen, wirkt. Fusionierte Personen sind in einem
erregten Zustand noch mehr bereit für die Gruppe zu handeln. Des weiteren konnte
nachgewiesen werden, dass die Identitäts-Fusion ein besonders Potential besitzt, extremes
Pro-Gruppen-Verhalten vorherzusagen. (Swann et al., 2010)
Der zweite Artikel erweitert das Modell der Fusions-Theorie um ein zusätzliches
Messinstrument. Während zuvor nur Fusion nur mit einem Item in einem bildlichen
Verfahren erfasst wurde, benutzt man nun ein verbales mit sieben Items. Durch diese
Änderung wird eine zuverlässigere Messung gewährleistet. Für dieses Verfahren spricht
außerdem, dass Fusion nun keine dichotome Variable mehr darstellt, sondern stetig ist.
Genau wie im Haupttext wird Fusion wieder mit der Social-Identity-Theorie verglichen
und erneut wird festgestellt, dass Fusion ein besseres Konzept ist um extremes Pro-
Gruppen-Verhalten vorherzusagen.
Außerdem wurde die Natur der Fusion genauer definiert; sie basiert auf einem starken
Gefühl der Verbundenheit und wechselseitiger Stärke. Ausgehend davon wurde versucht
zu erklären, wieso Menschen sich extreme Situationen aussetzen würden um der Gruppe
zu helfen.
Fusionierte Personen fühlen nicht nur eine starke Verbundenheit mit der Gruppe, sie
empfinden auf Grund dessen auch ein hohes Verantwortungsgefühl, was Pro-Gruppe-

!
!"'!
Verhalten erklärt. Da die Bereitschaft für Pro-Gruppen-Verhalten auch gegeben ist, obwohl
es extrem und riskant ist, kann nur durch ein Gefühl der Unverwundbarkeit erklärt werden.
Dieses wird begründet durch die wechselseitige Stärke, oder anders ausgedrückt,
fusionierte Personen projizieren ihr hohes Verantwortungsgefühl auch auf ihre
Gruppenmitglieder. Daraus schließen sie, dass andere Gruppenmitglieder gleich wie sie
handeln würden, was eine Unverwundbarkeit der Gruppe zu Folge hätte. (Swann et al.,
2011)
Der dritte Artikel gibt vor allem einen Überblick über alle bisherigen Forschungen zur
Identitäts-Fusion. Das Konzept wird erweitert indem vier maßgebliche Prinzipien für die
Theorie definiert werden, sowie nun auch nach Gründen für den Mechanismus der
Identitäts-Fusion gesucht wird. Fusion könnte zum Beispiel aus evolutionstheoretischer
Perspektive als Nebenprodukt einer Überlebensstrategie erklärt werden. Des weiteren gibt
es bestimmte Umfelder, die sich als besonders Fusions-freundlich erweisen.
Obwohl eines der vier Prinzipien besagt, dass eine Fusion mit einer Gruppe etwas sehr
beständiges darstellt, gibt es auch die Möglichkeit eine De-Fusion zu erleben. Eine De-
Fusion kann erlebt werden, wenn sich die Gruppe fundamental ändert oder die Bindung zu
Gruppenmitglieder reißt.
Es wird außerdem hervorgehoben, dass Fusion nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeutet,
obwohl sich sogar die Ausgangsfrage auf terroristische Aktivitäten bezieht. Es kann auch
ganz allgemein formuliert werden, dass Personen, die eine Identitäts-Fusion erlebt haben,
in jedem Fall die Gruppe bestärken und unterstützen, was in vielen Fällen auch etwas
positives sein kann.
3. Kritik und Anwendung
Bezüglich einer praktischen Anwendung des theoretischen Konzepts der Identitäts-Fusion
ergeben sich neue Ansätze zur Erklärung extremen Verhaltens in Gruppen. Speziell wenn
dieses Verhalten es verlangt, das eigene Wohl dem der Gruppe unterzuordnen. Swann und
seine Kollegen stellen die These auf, dass bisherige Forschung dieses Phänomen nicht
befriedigend erklären und vorhersagen konnte. Ein krasses Beispiel wäre ein
Selbstmordattentäter, der sein Leben zugunsten der Ideologie seiner Gruppe opfert. Im
Gegensatz zu früheren Annahmen, dass ein Attentäter zu dieser Handlung genötigt oder
überredet wird, deuten die Studien von Swann und Kollegen an, dass er eher von sich aus

!
!"(!
dazu bereit ist, da er sich in besonderer Weise für die Gruppe verantwortlich fühlt. Zudem
schreiben fusionierte Personen auch den anderen Gruppenmitgliedern dieses besondere
Verantwortungsgefühl zu, was zu einer scheinbaren Unverwundbarkeit der Gruppe führt.
Dieses neue Verständnis von terroristischer Motivation könnte im weitesten Sinn zu einer
besseren Beurteilung von extremistischen Gruppen beitragen. Mit fortschreitender
Forschung könnte es auch möglich sein, diese Theorie für positive Zwecke zu nutzen,
indem man fusionierte Gruppen bildet, die Menschen helfen.
Trotz dieser Aussichten ist unserer Meinung nach die Identitäts-Fusion noch nicht ganz
ausgereift, da uns einige Ungereimtheiten aufgefallen sind:
Gleich die Ausgangsthese besagt, dass es speziell starke Persönlichkeiten sind, die zu
solchen Taten fähig sind und nicht wie bisher angenommen schwache; diese Behauptung
wird allerdings unserer Meinung nach nicht ausreichend erklärt.
Eine weitere Frage, die wir näher betrachten würden, wäre die des Prototyps. Im
Hauptartikel wird diese nur mit Hilfe eines Items gemessen, was die Validität dieser
Messung sinken lässt.
Anknüpfend an diese Frage, wird im Hauptartikel behauptet, dass fusionierte Personen sich
auch darüber definieren, dass sie sich als einen außergewöhnlichen Teil der Gruppe
wahrnehmen. In den Folge-Studien wird jedoch betont, dass fusionierte Personen ihr
Verhalten auch den anderen Gruppenmitgliedern zuschreiben würden.
Des weiteren ist zu erkennen, dass oft mit unausgewogenen Stichproben gearbeitet wurde.
So bleiben also noch einige offene Fragen, die hoffentlich in weiteren Studien beantwortet
werden.
Fusion vermag zwar auch nicht endgültig eine Erklärung zu liefern, vergrößert aber das
Verständnis eines solchen Verhaltens, indem sie zumindest die Tendenz extremes,
risikoreiches Verhalten zugunsten der Gruppe zu zeigen, vorhersagen kann.

!
!#*!
5. Literaturverzeichnis
Brewer, M.B., Gardner, W.L. (1996). Who is this “we”? Levels of Collective Identity and
Self Representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 83-93.
Brinol, P., Petty, R. E., & Gallardo, I. (2007). The effect of self-affirmation in nonthreatening persuasion domains: Timing affects the process. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 1533–1546.
Buss, D.M. (2004). Evolutionäre Psychology (2. aktualisierte Auflage). München: Pearson
Studium
Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2008). Social Psychology (Fifth Edition). Harlow: Pearson
Education Limited
Hogg, M.A. (2007). Uncertainty–identity theory. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in
experimental social psychology. (Vol. 39, pp. 69–126). San Diego, CA: Academic Press.
Sageman, M. (2004). Understanding terror networks. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
Schubert, T., & Otten, S. (2002). Overlap of self, ingroup, and outgroup: Pictorial
measures of self-categorization. Self & Identity, 1, 535–576.
Swann Jr., W.B., Gómez, A., Brooks, M.L., Buhrmeister, M.D., Vazquez, A., Jetten, J.
(2011). On the Nature of Identity Fusion: Insights Into the Construct and a New Measure.
Journal of Personality and Social Psychology, 100 (5), 918-933.
Swann Jr., W.B., Gómez, A., Huici, C., Morales, F., & Hixon, J. G. (2010). Identity fusion
and self-sacrifice: Arousal as catalyst of pro- group fighting, dying, and helping behavior.
Journal of Personality and Social Psychology, 99, 824–841.

!
!#)!
Swann Jr., Gómez, A., Jetten, J., Whitehouse, H., Brock, B. (2012) When Group
Membership Gets Personal: A Theory of Identity Fusion. Psychological Review, 119 (3).
441-456
Swann Jr., W.B., Seyle, D.C., Gómez, A., Morales, J.F., Huící, C. (2009). Identity Fusion:
The Interplay of Personal and Social Identities in Extreme Group Behaviour. Journal of
Personality and Social Psychology, 96 (5), 995-1011.
9. Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Messinstrument für Identitätsfusion Seite 11
Abbildung 2: Study 1: Willingness to fight for the group Seite 14
Abbildung 3: Study 1: Willingness to die for the group Seite 15
Abbildung 4: Study 2: Willingness to fight for the group Seite 18
Abbildung 5: Study 2: Willingness to die for the group Seite 18
Abbildung 6: Study 3: Willingness to die for the group Seite 21
Abbildung 7: Study 3: Certainty of personal Identities Seite 22
Abbildung 8: Studie 1: Bereitschaft zu extremen Gruppenverhalten Seite 25
Abbildung 9: Verbal Fusion Scale Seite 29
Abbildung 10: Faktorenanalyse Fusion und Identifikation Seite 30
!