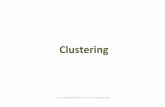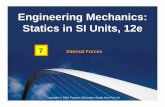04a 2003
-
Upload
lch-dachverband-schweizer-lehrerinnen-und-lehrer -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of 04a 2003

Z E I T S C H R I F T D E S L C H 4 a / 2 0 0 3
Sonderheft Schulreisen• Kopfreisen handfest: Museumspädagogik
Startbereit?• Die Checkliste für Lehrerinnen und Lehrer
Am Brennpunkt• Auf Schulbesuch im kriegsversehrten Kosovo

Inhalt
Aktuell4 Museumspädagogik: «In der Kunst
spazieren gehen»8 Freilichtmuseum Ballenberg:
Geschwungen und handgeknetet11 Lernmuseum Kulturama: Das Hirn
des Dinos in der Hosentasche
Reportage14 Dem Luchs auf der Spur in der Lenk30 Schulalltag im Kosovo
Reiseziele17 46 Ideen der SBB19 Schwyz: Forum der Schweizer
Geschichte21 Heimisbach: Schul- und Dichter-
stube von Simon Gfeller 22 Zu den Energiequellen der Schweiz27 Fricktaler Höhenweg
Tipps17 Der beste Termin für die Schulreise24 Startbereit mit der Checkliste der
bfu für die Vorbereitung der Schul-reise
LCH-Dienstleistungen23 Versicherung «Lehrer Plus»26 Studiosus
Zur Zeit37 Unpolitische Jugend:
«Die Ego-Taktiker auf der Strasse»
Magazin32 Reisen mit Dölf Reist41 Impressum
Rufnummer47 Glitzertop und Schmuddelshirt
Titelbild: Reisen mit Lerneffektdank professioneller Museums-pädagogik (Kulturama)Foto: Doris Fischer
Nummer 4a . 2003, 15. April 2003
Zeitschrift des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH)148. Jahrgang der Schweizer Lehrerinnen-und Lehrerzeitung (SLZ)
Guten Schulreisetag
24, 25, 26, alle Drittklässler sitzen nach kurzem Gerangel im Zugund 26 stehen eine gute Stunde später einigermassen geordnet auchwieder auf dem Perron. «Wie lange müssen wir Zweierkolonnemachen?» «Dürfen wir noch rasch an den Kiosk.» «Nein, aberwenn wir die Hauptstrasse hinter uns haben, dürft ihr frei laufen.» Eine erste Hürde auf der Schulreise ist damit einigermassen flottgenommen und zufrieden trottet der kunterbunte Haufen waldwärts.Aber eine lange Verschnaufpause für die Lehrerin ist nicht drin. Mit-tagsrast: «Nicht mit offenem Sackmesser rumlaufen, wer seinenStecken geschnitten hat, macht es zu und vergräbt es wieder imHosensack! Verstanden?» Der Rest ist Vertrauen und hoffen, dassdas Verbandszeug im Etui komplett ist. Auf dem zweistündigen Rückmarsch gilt es, die Hintersten anzutrei-ben und die Vordersten nicht aus den Augen zu verlieren. Dürfen wirein Stück vorauslaufen?» «Aber spätestens an der nächsten Weg-kreuzung wartet ihr auf uns.» Die kommt nach einer guten Viertel-stunde, von den Boys keine Spur. Auch an der nächsten undübernächsten keine Menschenseele und die Mischung aus Wut undAngst steigt zum Halszäpfchen. Dass das letzte Teilstück der Aareentlang führt, trägt nicht zur Beruhigung bei. Wenn die sich verlau-fen haben oder gar Blödsinn machen am Aareufer. Nur jetzt nichtHorrorszenarien ausdenken! Am Bahnhof sitzen sie gemütlich aufdem Bänklein – mit Unschuldsmine und flapsigen Sprüchen. DieStandpauke folgt sogleich – die Erleichterung mit Verzögerung. Ganz anders ging unser Klassenlehrer im Gymnasium mit unseremUngehorsam um. Nachdem wir mit einer Abkürzung auf einemGewaltmarsch den aktiven SAC-Veteranen ausgetrickst hatten,erklärte er sich kurzerhand ausserstande, mit uns die bevorstehendeMaturareise anzutreten. In die Puszta begleitet uns ein paar Monatespäter ein mutiger Kollege, allerdings nicht bedingungslos. SeineBedenken, wir könnten vom Weg abkommen, waren allerdings ganzanderer Natur: Keine Abwege, die sich in neun Monaten auswirken!Dafür dass unser Lehrer dann in Budapest am Abend jeweils nacheinigen Gläsern Roten den richtigen Weg ins Hotel fand, waren wirSchülerinnen besorgt. Für die bevorstehenden Schulreisen wünschen wir allen Lehrerinnenund Lehrern die richtige Mischung aus Lockerheit und Strenge, Ver-trauen und Vorschriften und jede Menge Spass.
Doris Fischer

Isabel Zürcher ist bei der Basler Kunst-halle zuständig für Bildung und Ver-mittlung. Wie bringt sie Museumspäda-gogik und zeitgenössische Kunst untereinen Hut? «Die Herausforderung be-steht weniger darin, dass es sich inunserem Fall um zeitgenössische Kunsthandelt als in den Rahmenbedingun-gen, unter denen solche Kunst-Dialogestattfinden können», sagt die Kunsthis-torikerin.
Madlen Blösch
An erster Stelle nennt sie die beschränk-te Zeit, die für schulbezogene Ausstel-lungsbesuche zur Verfügung steht: sel-ten sind es mehr, häufig weniger alseineinhalb Stunden. Weiter erwähnt sieden Fach-Zusammenhang wie Zeichnenoder Kunstbetrachtung, der häufig denRahmen für einen museumspädagogi-schen Besuch bilde.
So gut wie nie würden die Schüler vomDeutschlehrer begleitet oder von einerLehrperson, die Philosophie oder Geo-graphie unterrichtet. «Das ist schade.Denn von den Themen der Kunst herexistiert keine Einschränkung. Sie öff-net in vielerlei Hinsicht den Blick aufWirklichkeit und Wirklichkeiten, sieformuliert Visionen oder stellt auf krea-tive Weise scheinbar feststehendes Wis-sen in Frage.»
44 a • 2 0 0 3
Museumspädagogik:«In der Kunst spazieren gehen»Kinder und Jugendliche in Berührung mit Kunst zu bringen ist Sinn und Zweck der Museums-pädagogik. Das Zusammentreffen von kindlicher Unbefangenheit und ausgebildetem Fachwissenkann zu spannendem Austausch führen. BILDUNG SCHWEIZ wollte wissen, wie museumspädago-gische Dienste ihre Aufgabe umsetzen – zum Beispiel in Aarau, Basel, Burgdorf und Glarus.
«Kunst öffnet den Blick auf die Wirklichkeit.» – Kinder zu Besuch in der Kunsthalle Basel.
Foto
: Erw
in Z
bin
den
/zV
g

Kunstbetrachtung als ein autonomesFach oder starr in den Zeichenunter-richt integriert anzubieten, zeuge vomMissverständnis, dass Kunst ein von dersonstigen Welt abgesondertes Terrainbeschreibe.
Basel: Kunst-DialogeIsabel Zürcher anerkennt, dass es zeit-genössische Ausstellungen gibt, dieschwierig zu vermitteln sind oder Vor-kenntnisse verlangen. Komplexe Inhal-te seien nicht auf die Schnelle vermittel-bar. Es gelte, auf Alter, Interessen undSprachkompetenz Rücksicht zu neh-men. «Wenn ich weiss, dass eine Aus-stellung für gewisse Altersstufen schwerkonsumierbar ist, streue ich die Infor-mationen anders.»Wichtig sei jedenfalls, dass sie sich voreinem Besuch einer Gruppe informiere,wie diese zusammengesetzt sei und wiesie funktioniere, welche Unterrichts-sprache gefragt sei und speziell: «Wokann ich die Schüler und Schülerinnenabholen?»Seit anderthalb Jahren arbeitet IsabelZürcher im Projekt «Kunst-Dialoge» mitSchulen, Universität und Hochschulenzusammen. «Wir schlagen eine Brückezu Gruppen, die ausserhalb des Kunst-und Ausstellungsbetriebs etwas überkünstlerische Positionen lernen möch-ten.» Die Ausschreibung der «Kunst-Dialoge» erfolgt über eine Lehrperso-nenkartei mit über 100 Adressen.Zudem finden regelmässig Lehrer-führungen statt und ein neu angebote-ner Fortbildungskurs zum Thema «IstKunst vermittelbar?» stiess auf grossesInteresse.Als kleines Handicap erwähnt sie dieTatsache, dass sich der Besuch derKunsthalle auf die vorhandenen Räumekonzentrieren müsse, weil keine Werk-statt zur Verfügung stehe. «Wenn bei-spielsweise die Dynamik in der Gruppe
explodiert, kann ich nicht einfachsagen, jetzt arbeiten wir von Hand wei-ter.»
«Das ist doch total schräg»Was fasziniert sie an dieser Arbeit? «Esist der andere Blick, der mich fasziniertund oft auch meine Haltung korrigiert.Manchmal bin ich irritiert über meineneingeschränkten Fokus. Gerade in derArbeit mit Kindern und Jugendlichenbraucht es eine andere Sicht, eine ande-re Sprache.» Isabel Zürcher erinnert sich an einenGruppenbesuch während der Ausstel-lung mit fotografischen Körperansich-ten von Hannah Villiger. Als sie in dieRunde von Mädchen fragte, was sie indiesen Fotos sähen, herrschte vorerstbetretenes Schweigen. Schliesslichmeinte eine Jugendliche trocken: «Dasist doch total schräg.» Das Eis war gebrochen. «Mit einem ein-zigen Satz war mein ganzes kunsthisto-risches Konstrukt über die Bedeutungvon Villiger im Kontext der künstleri-schen Fotografie in der Schweiz irrele-vant. Für jedes Bild gibt es so vieleBlicke wie Leute und so viele Möglich-keiten der Beschreibung wie individuel-le Erfahrungshorizonte. Für mich ist oftdas oberste Gebot, die Stille auszuhaltenund diese nicht mit meiner wissen-schaftlich geprägten Sprache zuzu-decken.» Wichtig sei, spontan artikulierte Wahr-nehmungen ernst zu nehmen. Nur soliessen sich zwischen Kunst und Schul-kindern oder Jugendlichen Brückenschlagen. «Obwohl Kinder und Jugendliche nichtdas primäre Zielpublikum der Kunsthal-le sind, ist es wichtig und spannend,Hemmschwellen zu durchbrechen.Kunst gehört nicht nur der Wissen-schaft und der Kunstkritik, sonderneiner breiten Öffentlichkeit. Kunst löst
bei allen Emotionen aus; selbst wenn esjene ist, dass der Betrachter nicht weiss,was er auf Anhieb damit anfangen soll.»Für Isabel Zürcher ist klar, dass derKunstbetrieb dieses Feedback von ver-schiedenen Zielgruppen braucht, damiter nicht zu elitär wird.
Aargau: Stumme SpaziergängeVon einem Brückenschlag zwischenDingen an ihrem Ort und Menschen ineinem bestimmten Umfeld spricht auchdie im Aargauer Kunsthaus tätige Muse-umspädagogin Franziska Dürr Reinhard.«Durch Impulse soll die Wahrnehmungder Beteiligten gegenüber den ausge-stellten Werken angeregt werden. ImAustausch mit anderen wird ein Zugangzur Kunst gefunden.» Im simplenAugen-offen-Halten bestärkt zu werden,wecke vielleicht Lust, später an den Ortder Kunst zurückzukommen – auf eige-ne Faust.Seit 1995 bietet Franziska Dürr Reinhardauch museumspädagogisch geprägte«stumme Spaziergänge durch die heili-gen Hallen» an, ein Angebot, das vonSchulklassen regelmässig und gernebenutzt wird.
Glarus: Bescheidenheit angesagtSeit gut drei Jahren bietet Christa Wie-denmeier im Kunsthaus Glarus Führun-gen und Kunstvermittlung für Schul-klassen an. Auch hier wird vor allemGegenwartskunst präsentiert. «Ich habeeine kleine Stammkundschaft, die sichlangsam vergrössert», erzählt sie imGespräch mit BILDUNG SCHWEIZ. Sie betont allerdings, dass verglichenmit grösseren Kunsthäusern bezüglichRaum und Finanzen Bescheidenheitangesagt sei. «Da das Kunsthaus amVormittag geschlossen ist, eignen sichdiese Zeiten besonders gut für Besuchevon Schulklassen. Ich setze mich mitjeder Ausstellung auseinander.»
5M U S E U M S P Ä D A G O G I K4 a • 2 0 0 3
«Für jedes Bild gibt es so viele Blicke wie Leute und soviele Möglichkeiten der Beschreibung wie individuelleErfahrungshorizonte. Für mich ist oft das oberste Gebot,die Stille auszuhalten und diese nicht mit meiner wissen-schaftlich geprägten Sprache zuzudecken.»
Isabel Zürcher, Museumspädagogin an der
Kunsthalle Basel

6M U S E U M S P Ä D A G O G I K4 a • 2 0 0 3
Ideal sei es, wenn eine Lehrkraft sichmit ihr in Verbindung setze und sie sichüber Klassenstufe, Erwartungen undden ungefähren Verlauf des Ausstel-lungsbesuches informieren könne. «Daich über keinen eigenen Atelierraumverfüge, sind die Lehrkräfte aufgefor-dert, Impulse und Inspirationen inihrem Klassenzimmer umzusetzen. Ichlasse die Schüler im Kunsthaus nur klei-ne Arbeiten wie Skizzen oder Notizenmachen.» Gegenüber zu viel Animation undEvents ist Christa Wiedenmeier skep-tisch: «Das Zentrum meiner Vermitt-lung ist die Kommunikation. Es freutmich immer, wenn sich Gespräche erge-ben, sei es mit mir oder unter denSchülern. Kunst hat zu tun mit Wissenund Erkennen, mit Gefühlen und Stim-mungen.» Kunst heisse auch Raum las-sen, Zeit lassen, Grenzen ausloten undsprengen. In der Kunst spazieren gehen,sich in Netze von Gedanken, Gefühlen,Erinnerungen und Träumen hingeben...
Burgdorf: «Chlefele und Löffele»Eine etwas andere Kultur bietet dasKornhaus, Schweizerisches Zentrum fürVolkskultur, in Burgdorf an. «Es ist sehrschwierig, heute Schulen für Themenwie Brauchtum oder Volksmusik zugewinnen, obschon vieles auch heutenoch allgegenwärtig ist», umschreibtThomas Aeschbacher seine ersten Erfah-rungen. Der museumspädagogische Dienst desKornhauses wurde erst vor gut einemJahr aufgenommen. Er umfasst persön-liche Beratung von Lehrkräften undSchülern aller Stufen, offene Beratungs-
«Da ich über keinen eige-nen Atelierraum verfüge,sind die Lehrkräfte aufge-fordert, Impulse und Inspi-rationen in ihrem Klassen-zimmer umzusetzen.»
Christa Wiedenmeier,Kunsthaus Glarus
«Noch kein eigentlicher Beruf»Museumspädagogik ist im deutschsprachigen Raum trotz mehreren Anläufenimmer noch nicht als eigentlicher Beruf zu erlernen. Die in den vergangenen20 Jahren entstandenen postgradualen Spezialausbildungen des deutschspra-chigen Raums sind mangels Finanzen derzeit stark im Umbruch. Neu ent-standene Weiterbildungen sind zum Teil noch als Pilotprojekte ausgelegt undverlangen ein grosses Engagement der Teilnehmenden. Die breiten Museo-logieausbildungen auf Grundstufe (vor allem in Deutschland) erfahren in denMuseen wenig Anerkennung. Am stärksten internationalisiert und damit auchprofessionalisiert sind die postgradualen Ausbildungen mit langjähriger Erfah-rung (Basel, Amsterdam).In der Schweiz steckt eine Aus- oder Weiterbildung spezifisch für Museums-pädagogen noch in den Anfängen (Pilotprojekt «kuverum»). Die übrigenNachdiplomausbildungen decken entweder den gesamten ArbeitsbereichMuseum («Museologie» in Basel) oder sogar das gesamte Arbeitsfeld Kunst(«Kunst + Beruf» in Bern) ab oder richten sich spezifisch an PraktikerInnen imweiteren Umfeld des Tourismus (patrimoine et tourisme). Auch die meisten inDeutschland und in Holland angebotenen Studien resp. Nachdiplomstudiensind allgemein ausgerichtet und berücksichtigen die Museumspädagogik nichtzentral. An der Humboldt-Universität in Berlin besteht die Möglichkeit,Museumspädagogik als Schwerpunktfach im Rahmen des Magisterstudien-gangs Erziehungswissenschaften zu wählen.Je nach Wahl des Studienangebots reicht die Studiendauer von mehrerenTagen bis zu 10 Semestern.
Aus einer Dokumentation der Schweizerischen Zentralstelle für Hochschulwesen: www.crus.ch/docs/iud/Museumspaedagogik.pdf
nachmittage und Anregungen für diePlanung und Durchführung von Projek-ten. Auch Workshops wie der Selbstbauvon Didgeridoos oder «Chlefele undLöffele» sind im Angebot des Kornhau-ses und stossen laut Aeschbacher bei derLehrerschaft auf gutes Echo. Hingegenseien keine Führungen für Schulklassen
vorgesehen. Die Lehrkräfte erhieltendurch den museumspädagogischenDienst «Hilfe zur Selbsthilfe» und könn-ten so den Unterricht im Museum sel-ber durchführen und gestalten. Erst zueinem späteren Zeitpunkt seien Lehrer-einführungs- und Fortbildungskursegeplant.
Weiter im Netzwww.kunsthausglarus.chwww.kornhaus-burgdorf.ch/museums-paedagogik.htmlwww.museenbasel.ch/museumsdienstewww.kuverum.ch – ein SchweizerKunstvermittlungsprojektwww.ag.ch/[email protected] – Kunst-Dia-loge in der Kunsthalle Basel
Komplexe Inhalte sind nicht «auf die Schnelle» vermittelbar.
Foto
: Ku
nst
hau
s G
laru
s/zV
g.

Tafelbutter, Kochbutter, Margarine – dieAuswahl an unterschiedlichen Markenim Kühlregal ist gewaltig. Welche Buttersoll ich einkaufen? Oder bevorzuge icheinen Brotaufstrich, der wie Butter aus-sieht, jedoch aus rein pflanzlichen Zu-taten besteht? Was macht Butter zuButter? Was braucht es dazu? Im Frei-lichtmuseum Ballenberg gehen wir mitdem Sonderprogramm «Süesse Anke!Butter handgemacht» der elementarenButterproduktion auf die Spur.
Barbara Gerhardt
An einem sonnigen Maimorgen um 10Uhr empfange ich muntere Drittklässle-rinnen und Drittklässer mit ihrer Lehre-rin am Eingang zum Museum. Als ichdas Programm erläutere, schauen michviele Kinder etwas verständnislos an:«Anke – was ist das?» Schnell wird klar,dass in ihrer Umgebung von Buttergesprochen wird. Der sprachliche Ein-stieg, inklusive fremdsprachige Bezeich-nungen, führt zur Frage: «Wie heisst dieButter, die ihr esst?» Nur wenige derKinder streichen reine Butter aufs Brot;fettärmere Produkte scheinen im Trendzu sein.Unser Weg führt nun ins «Östliche Mit-telland» zur Ausstellung «Milch RahmButter» mit einem grossen Sortiment antraditionellen Geräten und Gefässen.Als ich nun den Kindern drei verschie-dene Buttergeräte auf den Tisch nebendem Brunnen stelle und sie auffordere,diese mit Wasser zu füllen und auszu-probieren, packen sie tüchtig zu.
Faszinierendes Butterfass Eifrig wird gedreht, gekurbelt und ge-stossen. Insbesondere die Strömung, dieim Drehbutterfass entsteht, fasziniert.Es wird viel gelacht, weil es spritzt,wenn der Deckel offen ist. Ein paar Kin-der können sich kaum losreissen, als ichsie zur nächsten Station bringen will.Dort geht es darum, mit Hilfe von his-torischen Bildern und Fotografien die
Arbeitsschritte von der Milch im Euterder Kuh bis zum fertigen Butterbrotzusammenzustellen. Dass die Kuh amAnfang steht, ist bald einmal klar. Dochwie geht es weiter? Kommt zuerst dieBäuerin mit dem Stossbutterfass oderder Älpler, der die Butter knetet? DieKöpfe sind über Bilder- und Textkartengebeugt und es wird diskutiert undzugeordnet.Im nächsten Teil nehmen die Schülerin-nen und Schüler in Zweiergruppen dieAusstellung genauer unter die Lupe. Esherrscht ein geschäftiges Treiben undimmer wieder kommen individuelleFragen. Aber auch die Erfahrungsberich-te über Kühe, Milch, ähnliche Geräte
bei der Grossmutter oder über Ferien aufdem Bauernhof bleiben nicht aus. DieseErzählungen begleiten unseren weiternWeg in den Keller des Hauses von Sach-seln.
Arbeit für KinderDie Kinder treten vorsichtig ein, dennes ist dunkel, insbesondere an einemsonnigen Tag. Die Frage «Warum hat esnicht mehr Fenster?», kommt unweiger-lich. Wir klären die Vor- und Nachteiledes Kellers und als ich mich eine Weilespäter nach den Sichtverhältnissenerkundige, merken die Kinder, dass sichihre Augen an die Dunkelheit gewöhnthaben. Die Knaben und Mädchen grup-
84 a • 2 0 0 3
Foto
s: z
Vg
.
Geschwungen und handgeknetetGewollt oder aus Versehen – wer hat schon einmal Butter gemacht? Mit dem Mixer passiert es imNu, mit dem Butterschwingglas der Grossmutter braucht es Ausdauer. Museumspädagogin Barbara Gerhardt beschreibt für BILDUNG SCHWEIZ, wie sie im Freilichtmuseum Ballenberg dieAusstellung für Schülerinnen und Schüler zu einem handfesten Erlebnis macht.
Kinder blicken neugierig in die Werkstatt eines Handwerkers.

pieren sich wie selbstverständlich umden Tisch. «Machen wir jetzt Butter?»fragt ein gespannt blickender Junge.Mein «Ja» löst einen allgemeinen Jubelaus. Die Kinder sind kaum zu haltenund es ist gut zu wissen, dass sie dem-nächst körperlich gefordert sind.Es ist eine Arbeit, die früher häufig vonKindern ausgeführt wurde. Zuerst füllenwir Rahm in die alten Butterschwing-gläser. Das Schwingen kann losgehen.Schon nach wenigen Minuten kommtdie erste Frage, ob dies schon genug sei.«Nein, das ist erst ein bisschen schau-mig – hier ist Ausdauer gefragt.» Sieschauen sich den Inhalt in ihrem Glasgenauer an und realisieren, dass diesnoch nicht einmal Schlagrahm für einDessert ist. Langsam wird es ruhiger imRaum, alle sind gefordert.Für eine Weile arbeiten die Schülerin-nen und Schüler nur unter der Aufsichtder Lehrperson. In der Zwischenzeithole ich heisses Wasser für den Ab-wasch. Fett lässt sich mit kaltem Wasseraus dem Brunnen schlecht abwaschen.Als ich zurückkomme, hat eine Gruppebereits steifgeschlagenen Rahm und esbraucht nicht mehr viel, bis im Glaseine gelbliche Masse sichtbar wird.Helle Aufregung entsteht: «Sie, schauenSie!» – «Wir haben Butter!» – «Ist daswirklich Butter?»
Waschen, kneten, kostenWir schrauben das Glas auf und begut-achten den Inhalt. Ja, es hat geklappt:Butter und Buttermilch haben sich von-einander getrennt. Beides wird nunsorgfältig und mit Stolz herausgenom-men. Wer will, kann die Buttermilchprobieren. Die einen tun es liebendgerne, die anderen mit Skepsis und einJunge lehnt es völlig ab. Die Ge-schmäcker sind verschieden; die einenverziehen das Gesicht und die anderenkönnen kaum genug kriegen. Es ist fas-zinierend, die Gruppendynamik zubeobachten. Da die Kinder, die als Erstekosten, die Buttermilch mögen, animie-
9M U S E U M S P Ä D A G O G I K4 a • 2 0 0 3
ren sie die anderen zum Probieren unddie Reaktionen fallen mehrheitlichpositiv aus. Bei anderen Klassen erlebeich genau das Gegenteil.Die Butter muss nun noch gewaschenund geknetet werden. Ein Mädchendrückt immer wieder seine Händegenüsslich in die gelbliche Masse undknetet noch einmal und noch einmal.Da die Butter dadurch immer weicherwird, biete ich diesem Spiel Einhalt undwir verpacken die Butter, damit sie nachHause transportiert werden kann. Biszur Heimreise der Klasse lagert die But-ter im Keller und wird dann bereitsetwas fester sein.Zum Abschluss versammeln wir uns vordem Haus und lassen das Erlebte Revuepassieren: Was ist geblieben? Währenddie einen vom Butterschwingen schwär-men, erinnern sich andere ans Geräteausprobieren und ein Mädchenerwähnt den Melkstuhl, der an ihrenGrossvater erinnerte. Wer wird zu Hauseeinmal Butter machen? Einige Fingergehen in die Höhe. Wie viele werden es
wirklich tun? Die Schülerinnen undSchüler haben jedenfalls erfahren, wieButter entsteht, wie sie früher gemachtwurde und welch anstrengende Arbeitdamit verbunden ist. Bequemer ist esauf jeden Fall, wenn wir die Butter oderden Anken fein säuberlich verpackt imGeschäft kaufen können, darüber sindsich alle einig.
Die Autorin Barbara Gerhardt, lic. phil. I, studiertenach Abschluss des LehrerInnensemi-nars und ihrer Lehrtätigkeit Volkskundeund deutsche Sprachwissenschaft ander Universität Zürich. Sie projektierteund führte während acht Jahren Frauen-stadtrundgänge in Luzern. Im Freilicht-museum Ballenberg betreut sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin den Be-reich Kulturelle Vermittlung/Museums-pädagogik.
Weiter im ProgrammBildung & Vermittlung im Freilicht-museum für ländliche Kultur Ballen-berg: Erlebnistage: Volksmedizin, Nägel,Ziegel, Brot, Flachs, Butter, Holzkons-truktionen, Schule.Div. Rundgänge für das selbständigeEntdecken in Kleingruppen.Dokumentationen: Gehölzlehrpfad,Bauernhoftiere u.a.Öffnungszeiten: 15. April bis 31. Oktober2003, 10 bis 17 Uhr.
Weiter im NetzInformation & Anmeldung: Schweiz. Freilichtmuseum Ballenberg,Barbara Gerhardt, Bildung &Vermittlung,3855 Brienz, Tel. 033 952 10 30, Fax 033 952 10 39, www.ballenberg.ch, E-Mail [email protected]
Anke machen mit dem Butterschwingglas derUrgrossmutter ist anstrengend, aber lustig. Eine Arbeit, die früher häufig von Kindern verrichtet wurde.
Erfahren und erleben – mit demSchwingglas macht buttern Spass.

11M U S E U M S P Ä D A G O G I K4 a • 2 0 0 3
Lernmuseum «Kulturama»:Das Hirn des Dinos in der HosentascheIndividuelle Betreuung von Klassen und Gruppen wird gross geschrieben im Kultu-rama, Museum des Menschen, in Zürich. Auf der Zeitreise durch die Evolution und die Entwicklung des Menschen begegnen die Besucherinnen und Besucher echtenFundstücken und sind aufgefordert, selber zu forschen und zu entdecken.
Wessen Skelett ist denn das? Zu kleinfür eine Katze, zu gross für eine Ratte.Auf den Igel kommt niemand, und dieÜberraschung ist gross. Dass der mäch-tige Oberschenkelknochen, den dieMuseumspädagogin Judith Arnold vonder Wand nimmt, hingegen zu einemElefanten passt, ist den Viertklässlernder Zürcher Schule Grünau auf denersten Blick klar. Da ist doch im Ver-gleich dazu derjenige von Lucy, der Aus-tralopitekus-Frau, geradezu mickrig. DieBuben und Mädchen vergleichen die ent-sprechend eingefärbten menschlichenund tierischen Skelettteile. Und einigeHände schnellen in die Höhe, als nachderen genauen Bezeichnung gefragtwird.
Doris Fischer
Die Klasse von Elisabeth Ghilardi istzum ersten Mal im Kulturama. Aber dieThematik der Ausstellung ist nicht neufür die Kinder. «Evolution ist imMoment unser Thema im Unterricht»,bestätigt die Lehrerin, begeistert von derArt und Weise wie das «Museum desMenschen» aufgebaut ist. Der Mu-seumsbesuch ist demnach eine Wieder-holung und soll das im SchulzimmerErarbeitete vertiefen.
Eine Million Jahre, zwei ZentimeterIm Kulturama können sich die Besuche-rinnen und Besucher auf zwei Zeitreisenbegeben. Im Untergeschoss der städti-schen Liegenschaft im Zentrum derStadt Zürich wandern sie auf einemZeitband durch die Evolution, von derEntstehung der ersten Lebensformen biszu den Hochkulturen. Im Erdgeschossist der Gang durch ein Menschenlebenvon der Zeugung bis zum Tod aufge-zeigt. Möglich ist es aber auch, einzelneElemente wie Bausteine herauszugreifenund individuell in ein bestimmtesSchwerpunktthema einzusetzen. «Allesbei uns ist auf Didaktik ausgerichtet,aufs Einfache und Wesentliche konzen-triert und anschaulich dargestellt»,
streicht die Direktorin Claudia Rütschedie Vorteile des Kulturamas heraus.Nach knapp zwei Stunden ist es für dieMuseumspädagogin nicht einfach, die15 Schülerinnen und Schüler bei derStange zu halten. Aber die Demonstra-tion mit dem kleinen Baby-Skelett, des-sen Kopf bei der Geburt durch dasBecken der Mutter stösst, zieht noch-mals alle in den Bann. Sengül und Juliajedenfalls hat die Ausstellung gefallen:«Vor allem die ersten Menschen wareninteressant», meint Julia, und Sengül
zeigt sich beeindruckt von der Grösseder Dinosaurier.
Individuelle Kurse für jede KlasseAn diesem Dienstagmorgen ist gleich-zeitig eine Oberstufenklasse (9. Schul-jahr) aus Wiesendangen mit LehrerinSusanne Steinmann im Museum. Diese27 Jugendlichen werden von MirjamSarasin betreut.«Bei uns erhalten die Besucherinnenund Besucher nicht die übliche Füh-rung, sondern das Kulturama ist voll auf
Experiment mit der Reaktions- und Koordinationsfähigkeit des Gehirns.
Foto
s: D
ori
s Fi
sch
er

12M U S E U M S P Ä D A G O G I K4 a • 2 0 0 3
Museumspädagogik ausgerichtet unddie Mehrheit der Schulklassen undGruppen buchen bei uns einen Kurs»,betont Claudia Rütsche. Das kleineTeam besteht aus fünf gut ausgebildetenMuseumspädagoginnen, die auch ganz
spontan, je nach Fragen und Reaktio-nen der Schülerinnen und SchülerSchwerpunkte setzen können und denUnterricht individuell und nach vorhe-riger Absprache mit den Lehrpersonenzusammenstellen.
Wie das Kind durch das Becken der Mutter auf die Welt kommt.
«Alles bei uns ist auf Didak-tik ausgerichtet, aufs Einfa-che und Wesentliche kon-zentriert und anschaulichdargestellt.»
Claudia Rütsche, Direktorin des Kulturamas
An zentraler Lage in ZürichDas Museum wurde 1978 von Paul Muggler, als weltweit eines der ersten
Evolutionsmuseen gegründet. Die Ausstellungen «Der Mensch in derUrzeit» und «Der Mensch von der Zeugung bis zum Tod» waren von Beginnweg ein Erfolg, provozierten aber auch kontroverse Diskussionen. Beson-ders die Vermittlung des Themas Sexualität polarisierte und liess dieWogen zeitweise hochgehen.
Die Ausstellungen waren an wechselnden Standorten einquartiert, ehe dasMuseum in die städtische Liegenschaft an der Englischviertelstrasse 9 inZürich zog. An zentraler und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreich-barer Lage konnte es am 30. August 2001 eröffnet werden. Seither haben607 Schulklassen und Gruppen das Kulturama besucht und die unter-schiedlichen didaktischen Angebote in Anspruch genommen.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag 13 bis 17 Uhr. Samstag 13bis 16 Uhr. Am Vormittag ist das Museum für Schulen und Gruppen mitKursen und Führungen nach Vereinbarung geöffnet.
Auskunft und weitere Informationen unter Telefon 01 260 60 44, Fax01 260 60 38, oder im Internet unter www.kulturama.ch;mail@kulturama,ch
Angeboten werden auch spezielleWorkshops oder Gruppenarbeiten zubestimmten Themen, beispielsweisezum Thema Fossilien. «Wir haben auchschon mit Klassen Grabungen durchge-führt», schildert Rütsche das Angebots-spektrum. Im Museum ist auch jedeMenge Zusatzmaterial vorhanden undzur Illustration öffnet Claudia Rütscheeine der Schubladen unterhalb derVitrinen, die zusätzliches Knochenma-terial enthält. Und weil wir beim Que-ren des Raums in der Mitte dem riesigenDinosaurier begegnen, fördert sie ausder Hosentasche den Abguss des Dino-hirns und demonstriert, wo dieses imkleinen Schädel seinen Sitz hat. An verschiedenen Arbeitsstationen inder Ausstellung werden die Besucherin-nen und Besucher zu aktivem Mittunaufgefordert und zur selbstständigenEntdeckungsreise motiviert. So fordert«Sherlock Bones» – eine Comicfigur –auf, ihm bei der Lösung seines Fallesbehilflich zu sein. Die Hilfsdetektive ler-nen dabei eine Menge über menschli-che Anatomie. Ein Dino-Quiz vermitteltInfos über die ausgestorbenen Urtiere.Beliebt ist auch das Zuordnen von Or-ganmodellen im menschlichen Körperan einer anderen Arbeitsstation.
Arbeit mit echten FundstückenSpektakulär und aussergewöhnlich ist,dass die meisten Ausstellungsstücke,echt sind – auch Haut und Haare einesMammuts! – und die Schülerinnen undSchüler mit echten Präparaten arbeitendürfen. So bestaunen denn die Viert-klässler zum Schluss ihres Kurses die(echte) mehrere tausend Jahre alteMumie, deren Röntgenbild gar nochReste ihres Gehirns zeigt. Aus Kunststoff hingegen ist das farbigeModell in der Sonderausstellung «HirnArt» im Foyer des Museums (Titelbilddieser Ausgabe). Dort beenden die 9.-Klässler ihren Museumsbesuch undprüfen mit Experimenten die Reaktio-nen und Funktionen der verschiedenenBereiche des menschlichen Hirns.

Weg» lässt sich – in Betrachtung desWildstrubels aus gehöriger Distanz –innere Ruhe finden.
Im zweiten AnlaufIm Jahr 2000 gestaltete Gwer Allenbachin Zusammenarbeit mit dem BiologenRoland Luder und weiteren Helfernzuerst den Murmeli-Trail, dessen Kern-stück ein zugänglicher Murmelibau ist.Unmittelbar anschliessend, im Jahr2001, folgte der Luchs-Trail. Dabei zahl-ten die Initianten allerdings einigesLehrgeld: «Die erste Version war viel zulang und zu wenig attraktiv», berichtetAllenbach, «die Leute waren nach dreiStunden Wandern kaputt, und unsereLuchs-Attrappen hatten sie überhauptnicht gesehen.»Also vereinfachte und verkürzte mandas Projekt. Der neue Luchs-Trail –eröffnet im Sommer 2002 – ist nun denFüssen und Augen der Unterländerzuträglicher: Die Wanderer starten vonder Bergstation Leiterli (1950 m) undgehen vier Kilometer weit in meist sanft
144 a • 2 0 0 3
Samstag, 20. Oktober. Ende der Som-mersaison 2002 in Lenk im Simmental.Tags zuvor hatte es im Berner Oberlandeinen halben Meter Schnee hingelegt.«Ob der Weg wohl gepfadet ist?», fragtein der Gondelbahn am Betelberg derahnungslose Unterländer seinen einhei-mischen Führer. Und der antwortetemit feinem Lächeln: «Das machen wiram besten grad selber.»
Heinz Weber
Gwer Allenbach (48) ist seit 26 JahrenPrimarlehrer an der Lenk. Im WeilerPöschenried unterrichtet er 18 Bubenund Mädchen der 1. bis 6. Klasse. Er istleidenschaftlicher Bergsteiger und über-dies verantwortlich für Unterhalt undMarkierung der Wanderwege auf demGemeindegebiet.
Tourismus und Natur in EinklangDie Freude an der Natur einerseits unddas Interesse am Tourismus anderseitsbrachten ihn auf die Idee, zuerst einen
Murmeli-Trail und dann auch einenLuchs-Trail anzulegen. «Unser Wander-wegnetz kam mir vor wie ein unbearbei-teter Rohstoff», erzählte er, während wirdurch den kniehohen Neuschnee tal-wärts stapften. Lenk im Simmental leide – wie andereSki-Orte auch – an einer «einseitigenWertschöpfung». 90 Prozent des Umsat-zes werden im Winter erzielt, wenn Bah-nen und Lifte auf Hochtouren laufen.Wanderer hingegen lassen sich einmal,höchstens zweimal im Tag nach obenoder nach unten gondeln, und das Pick-nick bringen sie oft erst noch aus demSupermarkt mit. Kommt hinzu, dass dieKlimaveränderung auch das Winterge-schäft immer mehr zum Risiko macht.Wie aber mehr Sommertouristen, Fami-lien und Schulklassen anlocken ohnedie empfindliche Natur zu stören? Inder Lenk (Motto: «Etwas näher bei derNatur») setzt man auf «Erlebniswege».Schon länger gibt es etwa einen Al-penblumenweg, einen Bergwald- undeinen Geologiepfad; auf einem «Zen-
Mit Gwer Allenbach dem Luchs auf der SpurEinen frei lebenden Luchs zu sehen, ist auch auf dem Luchs-Trail in der Lenk ein absoluter Glücks-fall. Aber näher kommen kann man dem umstrittenen Raubtier ganz bestimmt. Initiant desLuchs-Trails ist der Lenker Lehrer Gwer Allenbach. BILDUNG SCHWEIZ liess sich von ihm führen.
«Ich war wohl etwas zu schwärmerisch.» – Gwer Allenbach vor einer Informationstafel des Luchs-Trails.
Foto
s: H
ein
z W
eber

Weiter im Netzwww.lenk.ch und www.betelberg.ch –touristische Informationen und Anga-ben zu den Erlebniswegenwww.kora.unibe.ch – Koordinations-stelle der Uni Bern für Forschungspro-jekte, die sich mit der Ökologie vonRaubtieren und ihrem Zusammenlebenmit den Menschen beschäftigen.
15R E P O R T A G E4 a • 2 0 0 3
meli hat sich bisher kaum erfüllt. «Ichwar wohl etwas zu schwärmerisch», gibtGwer Allenbach freimütig zu. Frustriertist er deswegen überhaupt nicht. DieZusammenarbeit mit Wildbiologen undTourismusfachleuten beim Bau derErlebniswege habe Spass gemacht. Und:«Wenn die Leute von hier etwas an Wis-sen über den Luchs und das Murmelimitnehmen, dann ist schon ein grossesAnliegen erfüllt.»
abfallendem Gelände bis zum Restau-rant Wallegg (1340 m). Immer wiederberichten Informationstafeln über denLuchs und seinen Lebensraum. Gwer Allenbach war es ein Anliegen,dass die Informationen nicht nur wis-senschaftlich korrekt und leicht lesbarsind, sondern auch ästhetischen An-sprüchen genügen. Das ist gelungen;man braucht keine halbe Stunde vorden Tafeln zu stehen, um ein paar präg-nante Fakten aufzunehmen. Materialzur Vor- oder Nachbereitung findet sichleicht im Internet.
Spielen und «luchsen»In der Umgebung der Tafeln sind le-bensgrosse Attrappen des Luchses, aberauch seiner Beutetiere platziert. Um siealle zu erkennen muss man auch bei derneuen, leichteren Version des Trails ge-hörig «luchsen» (Duden: «angespannt,aufmerksam spähend schauen, nachjmdm., etw. ausschauen»).Luchse sind verspielte Tiere. Auch aufdem Luchs-Trail kommen Spieltrieb undBewegungsdrang nicht zu kurz. DieSpielgeräte sind nicht Selbstzweck, son-dern haben alle mit dem Luchs zu tun –etwa wenn wir auf einer Reihe von freischwingenden Planken den federndenKatzengang nachempfinden oder einenächste Station uns zeigt, wie weit erspringen kann. Gebaut sind die Geräteübrigens aus «Lothar-Holz», das beimverheerenden Sturm Ende des Jahres2000 anfiel.
Umstrittener RäuberDas Murmeli haben alle gern; der seitden 70er Jahren in der Schweiz wiederangesiedelte Luchs ist auch und geradeim Simmental ein umstrittenes Raub-tier. Zwar frisst er in erster Linie Reheund Gämsen, doch entdecken einzelneTiere auch das Schaf als leichte Beuteund «spezialisieren» sich darauf. Zudemklagen viele Jäger, er pfusche ihnen insWaidwerk: Wo Luchse leben, ist dasWild aufmerksamer und die Jagdschwieriger.Etwa drei bis fünf Luchse leben nachSchätzung von Gwer Allenbach zeitwei-lig auf Lenker Gemeindegebiet (ohnesich freilich an dessen Grenzen zu hal-ten). Jäger und andere Raubtier-Skepti-ker reden von rund 30 Tieren, wasAllenbach für biologisch unmöglichhält. Obwohl der Bund Luchs-Schädenersetzt, kommt es immer wieder zu ille-galen und willkürlichen Abschüssen.Die Hoffnung auf zusätzliche Sommer-touristenströme dank Luchs und Mur-
Der Luchs (Lynx lynx)Der Luchs ist bei uns neben der Wildkatze das grössere der beiden katzen-
artigen Raubtiere. Das braune, leicht gefleckte Fell, der kurze, nur 20 cmlange Schwanz und die langen Haarbüschel an beiden Ohren (ca. 5 cmlange «Pinsel») zeichnen dieses Tier aus.
Luchse sind so schwer wie ein mittelgrosser Hund. Ausgewachsen wiegenWeibchen 17–20 kg, Männchen bis 25 kg. Luchse sehen ausgezeichnet,sind schnell und wendig. Junge Luchse spielen gerne und viel.
Die wald- und wildreichen Alpen- und Juralandschaften sind gute Lebens-räume für den Luchs. Der Luchsbestand richtet sich zu einem wesentlichenTeil nach dem Angebot an Beutetieren (v.a. Reh und Gämse). Er hängt auch stark von der Toleranz der Jäger und Schafhalter ab.
Luchsmännchen durchstreifen einen Raum von 60–150 Quadratkilometern, inwelchem auch ein bis zwei Weibchen leben. Erwachsene Luchse leben alsEinzelgänger und suchen einander nur zur Paarungszeit auf.
(Aus den Informationen zum Luchs und seinem Lebensraum auf der Internet-Site www.betelberg.ch)
Den federnden Gang des Luchses nachempfinden – aufeinem Spielgerät aus «Lothar-Holz».

17T I P P S4 a • 2 0 0 3
Hoffentlich spielt das Wet-ter mit...Die meisten Schulreisen fin-den an einem Dienstag oderDonnerstag im Juni statt. Dawird es schon mal eng aufdem Perron und in denZügen. Nützen Sie doch maleinen der sonnigen Maitagefür Ihre Reise und/oder einenMontag. Wählen Sie Ihr Rei-seziel so aus, dass Sie entge-gen den Pendlerströmen rei-sen oder verschieben Sie dieReisezeiten etwas. Um die Reisequalität zuerhöhen, haben die SBB ingewissen Zügen das Platz-angebot für Gruppen be-schränkt. Planen Sie deshalbfrühzeitig. Wir unterstützenSie dabei gerne. Jetzt mussalso nur noch das Wettermitspielen!
... und falls nicht?Die Wetterprognosen erhal-ten wir heute schon rundfünf Tage im Voraus. Ent-scheiden Sie frühzeitig, ob
Sie die geplante Reise durch-führen. Teilen Sie den SBBbitte spätestens 48 Stundenvor Reiseantritt (bei Abreiseam Montag oder Dienstag 72 Stunden vor Reiseantritt)eine allfällige VerschiebungIhrer Reise mit.
Auf der ReiseAlles gut geplant? Dannkann es ja losgehen. TreffenSie rund 15 Minuten vorZugsabfahrt am Bahnhof ein.Wir orientieren Sie überIhren Einsteigeort. KündigenSie den Teilnehmenden einallfälliges Umsteigen recht-zeitig an. Unsere Zugbeglei-terinnen und -begleiterunterstützen Sie gerne beimUmsteigen. Helfen Sie mit,dass die Züge ohne Verspä-tung weiterfahren können.Die übrigen Bahnbenützersind Ihnen dafür dankbar.Unvorhersehbares kann im-mer eintreten. Am Reisetagkönnen wir jedoch die Platz-reservation nicht mehr än-
dern. Melden Sie sich je-doch in einem solchen Fall beim nächsten Bahnhof oder beim RailService (Telefon0900 300 300), damit wirIhnen einen neuen Fahrplanmitteilen können.
Sicher ist sicherDie Schüler sind auf derSchulreise oft übermütig undausgelassen. Vermeiden SieSpiele auf dem Bahngebietund warten Sie mit IhrerKlasse hinter der weissenSicherheitslinie. Sie schützenso die Schüler vor den Gefah-ren durchfahrender Züge. Siebleibt der Abschluss desSchuljahres allen in positiverErinnerung. Ihre Reiseberater am Bahn-hof oder beim RailServiceunterstützen Sie gerne beider Organisation Ihrer Schul-reise. Gute Reise!
SBB AG, Division Personenverkehr,
Reto Staub
Es muss nicht immer Dienstag seinWelches ist der beste Termin für die Schulreise? Was tun, wenn unter-wegs Unvorhergesehenes passiert? Reto Staub von den SBB gibt Tipps.
SBB/RailAway
46 Ideen fürSchulreisen
Ob Velotouren, Rundwande-rungen mit herrlichen Al-penpanoramen, Brot backenauf 2000 m ü.M. oder einschwungvoller Trottispass –Der Schulreise-Prospekt vonRailAway, dem Freizeitunter-nehmen der SBB, enthält 46 vielfältige Angebote. DieGanztages- und Mehrtages-ausflüge mit Erlebnischarak-ter und didaktischem Inhaltführen in alle Regionen derSchweiz sowie ins grenznaheAusland. Erstmals in der Angebotspa-lette ist die grösste Baustellefür den Gotthard-Basistun-nel in Pollegio. Besonderseindrucksvoll ist die Besichti-gung der Baustelle unter Tag.Der Mystery Park in Interla-ken öffnet am 24. Mai 2003seine Tore und die grossenRätsel dieser Welt werdendort modellhaft und multi-medial präsentiert.Das Bahnbillett für Schul-angebote ist sieben Tage gül-tig. Somit kann z.B. die Fahrtins Klassenlager ideal miteinem RailAway-Schulange-bot kombiniert werden. DieSchulklassen profitieren von60 Prozent Ermässigung aufdie Bahnfahrt und starkermässigter Zusatzleistung.Zusätzlich ist jede zehntePerson gratis und dies für alleLeistungen.Die attraktive RailAway-Schulreise-Broschüre liegtdieser Ausgabe von BIL-DUNG SCHWEIZ bei, weitereExemplare sind gratis amBahnhof erhältlich. Sie hilftden Lehrerinnen und Leh-rern bei der Entscheidung fürdie nächste Reise. Die auf-wändige Informationsbe-schaffung von verschiede-nen Ausflugszielen fällt weg.Weitere Informationen beimRailService, Tel. 0900 300 300(Fr. 1.19 Min.) oder im Inter-net unter www.railaway.ch.
An Dienstagen und Donnerstagen im Juni wird es oft eng auf den Perrons und in den Zügen.
Foto
: zV
g.

19R E I S E Z I E L E4 a • 2 0 0 3
Wie riecht Männertreu?Haben Landschaften spezifi-sche Gerüche? Duften Lär-chen und Arven unter-schiedlich? Was hat der Bibermit der Parfümerie zu tun?Das Forum der Schweizer Ge-schichte in Schwyz – Inner-schweizer Standort der «Mu-sée Suisse Gruppe» – gehtvom 24. Mai bis 26. Oktober2003 mit einer Vielzahl vonDuftproben und kulturhisto-rischen Erläuterungen aufsolche Fragen ein.
Von blumig bis ranzigWer Ausstellungen nicht rie-chen kann, wird überraschtsein. Das Forum der Schwei-zer Geschichte in Schwyz hateinen feinen Weg der Kultur-vermittlung gefunden. Unterdem viel versprechendenTitel «Alpendüfte: Wie Gerü-che und Düfte die Kultureiner Landschaft prägen –Eine Ausstellung mit geruchssinnlichen Erlebnis-sen» verschafft sie einenvöllig neuen Zugang zumAlpenraum. «Alpendüfte» isteine sowohl kulturgeschicht-liche wie naturwissenschaft-liche Annäherung an die
sensorischen Phänomeneeiner Landschaft. Olfaktori-sche (den Geruchssinnbetreffende) Eindrücke wer-den dem Publikum einerseitsdurch die floralen Wohl-gerüche präsentiert. Auf deranderen Seite wird es auchmit den ranzigen bis stren-gen Gerüchen der Alpwirt-schaft konfrontiert.
Boudoir und GeissbockDie Besucherinnen undBesucher werden über künst-lerische Installationen zufünf thematischen Erlebnis-inseln geführt. In einemhistorischen Exkurs werdensie vorerst von den Düftendes Übersinnlichen verzau-bert. Hier der sakrale Duftvon Weihrauch und Myrrhe,dort Geister und Hexenabwehrende Kräuter. In der zweiten Erlebnisinselweht der Duft der feinenGesellschaft zu Beginn des18. Jahrhunderts. Das bür-gerliche Boudoir mit wohl-riechenden Toilettenarti-keln, duftenden Perückenund Handschuhen und Par-fumflacons aus der einzigar-tigen Sammlung der Familie
Givaudan eröffnet verklärtePerspektiven auf die Alpen.Das aufstrebende Bürgertumin den übel riechenden Städ-ten sehnt sich nach hehrenLandschaften mit frischerBergluft.Neben dieser Leichtigkeit desSeins wird der harte Alltagder Bergler gezeigt: eine tra-ditionelle Alphütte mit demsäuerlichen Geruch dermilchwirtschaftlichen Gerä-te, dem Gestank des altenGeissbocks und dem muf-felnden Militärkaput. Dieser Beschaulichkeit folgteine Insel der Konsumgesell-schaft. Markenartikel, mitAromen und Duftnoten derAlpenflora versetzt, schaffenWohlbefinden oder Illusio-nen.Das Ausstellungsthema wirdmit verschiedenen Begleitver-anstaltungen vertieft. Infor-mationen über das Kultur-und Bildungsprogramm fürSchulklassen während der Son-derausstellung «Alpendüfte»vermittelt das Forum derSchweizer Geschichte ab An-fang Mai: Tel. 041 819 60 11,www.musee-suisse.ch/schwyz
Yves Schumacher
«Alpendüfte» – sinnliches MuseumImmer der Nase nach: Olfaktorische Sensationen von blumig bis ranzigverschaffen Besucherinnen und Besuchern des Forum der SchweizerGeschichte in Schwyz einen neuen Zugang zum Alpenraum.
Polit-Forum desBundes imKäfigturmPraxisnahen Staatskunde-unterricht aus dem Bundes-haus bietet die Ausstellung«Chalet fédéral». Sie dauertbis 5. Juli.Wie ist es möglich, dass ineiner einzigen Bundesratssit-zung 50 Geschäfte behandeltwerden? Wie gelangen dieThemen auf die Traktanden-liste? Wie läuft eine Bundes-ratssitzung ab? Welches istdie Rolle der Kanzlerin? Kön-nen wir bald per Internetabstimmen? – AnschaulicheAntworten auf diese Fragenund vieles mehr bietet dieAusstellung «Chalet fédéral»im Rahmen des Jubiläums«200 Jahre Bundeskanzlei»,welche vom 10. April bis 5.Juli 2003 im Polit-Forum desBundes gezeigt wird. Einer-seits geht es dabei um dieGeschichte der Bundeskanz-lei, anderseits um das Funk-tionieren der eidgenössi-schen Politik. Angesprochen sind in ersterLinie Schulklassen. Feed-backs von Lehrkräften undJugendlichen zeigen, dasspolitische Themen in derSchulstube nicht leicht zuvermitteln sind. Die Bundes-kanzlei eignet sich für politi-sche Bildung besonders, dasie als Stabsstelle des Bundes-rates bei allen wichtigen Pro-zessen mit einbezogen ist. Auf Anmeldung führenFachleute der Bundeskanzleidurch die Ausstellung undbeantworten Fragen. Dazugibt es ein Quizspiel «Werwird 8. Bundesrat?», in demattraktive Preise zu gewin-nen sind. Info und Anmel-dung: Polit-Forum im Käfig-turm, Susanne Daxelhoffer,Telefon 031 324 71 73, Fax031 323 59 20, [email protected],www.kaefigturm.admin.ch.Anmeldung für Führungendurch das Bundeshaus (nurausserhalb der Sessionen):031 322 85 22.
Alpenwiese: Hort floraler Wohlgerüche und strengranziger Nasenquäler.
Foto
: zV
g.

21R E I S E Z I E L E4 a • 2 0 0 3
’s Waldgüetli sunnet si uf emeHügelrüppi obe, wo si zwüschezwöi chlynni Tääli yhe gschobehet. ’s Schuelhus steit no hütdert, wo die beede Grebe zäme-chöme. So het der Chlyn linggsoder rächts chönnen i Grabenahe ha oder irgetwo uber dasHügelrüppi uus, ’s Schuelhuushet er nid chönne verfähle.
Wem diese Stelle aus demWerk «Drätty, Müetti u derChlyn» nicht gerade chine-sisch vorkommt, der dürftedas alte Schulhaus im Em-mental wohl ebenfalls fin-den und wird mit Interessedie «Simon-Gfeller-Gedenk-stube» betreten. Der BernerDichter (1868–1943) ist hierzur Schule gegangen und hatspäter am gleichen Ort einigeJahre als Lehrer gewirkt.Nicht nur über Gfellers be-wegtes Leben und das Entste-hen seiner Geschichten lässtsich in dieser Stube viel er-fahren, sondern ebenso überdie Art, wie im vorletztenJahrhundert Landkinder auf-wuchsen und lernten. Des-halb lohnt sich der Besuchauch für Schulklassen – gut
zu verbinden mit einer Wan-derung durch die Emmenta-ler Landschaft nach SchlossTrachselwald oder nach Lüt-zelflüh, wo die Brücke zuGotthelf zu schlagen wäre.
Kenntnis und EngagementBetreuer dieser Stube ist Wal-ter Herren, ehemaliger Präsi-dent der Medienkommissiondes LCH. In den sechzigerJahren war er selbst Lehrerhier im Dorf, das damals«Dürrgraben» hiess. 1968, zuGfellers 100. Geburtstag,wurde es in «Heimisbach»umbenannt – so wie es derDichter in seinem populärs-ten Werk verewigt hatte.Walter Herren richtete ausdiesem Anlass die Ausstel-lung im alten Schulhaus ein,die danach zur festen Institu-tion wurde. Er ist auch Präsi-dent der 1970 gegründetenStiftung mit der Aufgabe,Gfellers Werk «zugänglich zuerhalten».Falls es die Zeit erlaubt, führtHerren gerne selbst durchdas kleine Museum. Er er-zählt als intimer Kenner ausdem Leben des Dichters und
liest dazu mit spürbaremEngagement und Wärme dieentsprechenden Textstellenaus Gfellers Mundartge-schichten und Tagebüchernvor. Heinz Weber
Simon-Gfeller-Gedenkstubeim alten Schulhaus Thal,Heimisbach, geöffnet von 8.April bis 31. Oktober, täglich8–18 Uhr. Auskunft: WalterHerren, Tel. 031 721 13 50, E-Mail [email protected]
Weiter im Netzwww.heimisbach.ch – Rubrik«Vereine», Simon-Gfeller-Stif-tung
Weiter im Text«Heimisbach» und «Lehrewärche», berndeutsche Ge-schichten von Simon Gfeller,illustriert mit eindrücklichenFotos aus dem einstigen Bau-ernleben und der Emmen-taler Landschaft; 2001/2002Licorne-Verlag, Langnau, jeFr. 38.–, erhältlich im Buch-handel oder direkt bei derSimon-Gfeller-Stiftung; eindritter Band ist in Vorberei-tung.
Die Schulstube eines DichtersWalter Herren, ehemaliger Präsident der Medienkommission des LCH,betreut mit Leidenschaft den Nachlass des Dichters Simon Gfeller.
Marionetten-Museum
Zu neuemLeben erwecken Die Marionetten im MuséeSuisse de la Marionette inFribourg sind zwar verbanntin Vitrinen; wenn sie jedochBesuch von Schulklassenoder Gruppen empfangen,dann werden sie aktiv, bewe-gen ihre steifen Glieder undzeigen, wie viel Leben nochimmer in ihnen steckt. Die Verantwortliche des Mu-seums, Marens Jans, zeigt Be-sucherinnen und Besuchernfünf Beispiele, wie die Figu-ren «gespielt» wurden. Kin-der dürfen auch selber einKasperlitheater inszenieren.Auf Wunsch organisiert dasMuseum mit der hauseige-nen Truppe ein kleines Spiel.Musée Suisse de la Mario-nette, Derrière-les Jardins 2,1701 Fribourg; Montag bisFreitag von 10 bis 12 Uhr,Samstag und Sonntag von 14bis 18 Uhr. Gruppenführun-gen auf Bestellung. Rund-gang mit Spiel Fr. 100.–,zusätzlich Fr. 100.– für Spielder Truppe.Information und KontaktTel. und Fax 026 322 85 13,www.marionette.ch, [email protected]
Zollmuseum Gandria
Schmuggler undGrenzerDas Schweizerische Zollmu-seum in Gandria gibt Ein-blick in die Zoll- und Grenz-geschichte von der Mitte des19. Jahrhunderts bis heute.Moderne Technik und Inter-aktivität machen daraus einelebendige Ausstellung fürJung und Alt. Das «Schmugg-lermuseum», wie es imVolksmund auch heisst, istnur mit dem Schiff erreich-bar. Geöffnet 13. April – 26.Oktober, 13.30 bis 17.30Uhr. Seefahrplan: www.lake-lugano.ch. Weitere Aus-kunft: Zollkreisdirektion Lu-gano, Telefon 091 910 48 11,Fax 091 923 14 15, E-Mail:[email protected]
Walter Herren in der Simon-Gfeller-Gedenkstube in Heimisbach.
Foto
: Do
ris
Fisc
her

22R E I S E Z I E L E4 a • 2 0 0 3
Gigantische Staumauern, so hoch wieder Eiffelturm, geheimnisvolle Kaver-nen unter dem See, die steilsten Werks-bahnen der Welt und vieles mehr kön-nen Besucherinnen und Besucher vonWasserkraftwerken erwarten. Inmitteneiner grossartigen Fluss- oder Bergland-schaft bieten sich traumhaft schöneWanderungen. Alle 30 im neuen Buch «Erlebnis Was-serkraft» zusammengestellten Ausflügelassen sich mit einer interessanten Be-sichtigung der Wasserkraftwerke verbin-den. Wir erkunden dunkle Kontroll-gänge in einer Staumauer, fahren mitabenteuerlichen Seilbahnen über tiefeSchluchten, sehen Wasserhähne mit biszu drei Meter dicken Leitungen und ler-nen, dass die Wasserkraft eine saubereund erneuerbare Energiequelle ist.Alle im Buch vorgestellten Kraftwerkebieten einen Besucherdienst.
Weiter im TextGohl/Nef/Collet: «Erlebnis Wasser-kraft», Edition Lan-el, Zug, 2003, 192Seiten, 13 x 22 cm, über 150 Farbbilderund viele Karten, Text Deutsch/Franzö-sisch kombiniert. Für Leserinnen undLeser von BILDUNG SCHWEIZ gilt einSubskriptionspreis von Fr. 29.80 statt Fr. 39.80 (Inserat Seite 20 dieser Ausgabe).
Weiter im Netzwww.editionlan.com, Zug
Erlebnis WasserkraftEin neues Wander- und Entdeckungsbuch führt zu Energiequellen der Schweiz. Leserinnen undLeser von BILDUNG SCHWEIZ erhalten es zu einem Spezialpreis.
400 Millionen Kubikmeter Wasser hinter der Staumauer «Grande Dixence».
Tunnels und Stollen am Lac de Mauvoisin.
Führung durchs Stauwehr Lüen im Schanfigg (Chur-Arosa).Kraftwerks-Standseilbahn Lüen.
Foto
: Ro
nal
d G
oh
lFo
to: R
on
ald
Go
hl
Foto
s: A
rosa
En
erg
ie

244 a • 2 0 0 3
tionen und Anregungen für Lehrper-sonen, direkt bei der bfu erhältlich.
Checklisten sind effiziente Planungs-und Vorbereitungsinstrumente fürschulische Aktivitäten ausser Haus –
Die Checkliste auf diesen Seiten samtNotfallkarte ist ein Vorabdruck ausdem neuen Safety Tool «Wanderun-gen» der Schweizerischen Beratungs-stelle für Unfallverhütung (bfu). Sieist, ergänzt durch wervolle Informa-
Startbereit? – Die Checkliste für Lehrpersonen
Wanderziel und Wanderroute festlegenBegleitperson(en) anfragen RekognoszierenBudget festlegenEltern informierenKollegen informierenBehörden informierenFahrpläne studierenReservationen tätigenEvtl. Schuhe kaufen und einlaufen..................................................................................................................................
30 –15 Tage vor der WanderungBegleitpersonen der Klasse vorstellenDefinitive Route besprechen, Gefahren analysierenBefahrene Strassen meidenZeitplanung: etwa doppelt so lange wie beim Rekognoszieren Kondition der Schwächsten berücksichtigenTageslichtdauer berücksichtigenRoutenskizze mit Profil erstellenRastorte festlegenMögliche Ausstiegs- und Umkehrstellen bestimmenVerhaltensregeln (Kodex) aufstellenbfu-Ib 0303 «Bergwandern» besprechenSzenario für spezielle Passagen besprechen und übenZusammenstellung der Gruppe besprechenCheckliste für persönliche Ausrüstung erstellenCheckliste für allgemeine Ausrüstung erstellen Ausrüstung anhand der Checkliste überprüfen Fehlendes organisierenNotfallkarte ergänzen, kopieren, ausschneidenDefinitives Programm zusammenstellenProgramm den Eltern und Begleitpersonen abgeben..................................................................................................................................
2 – 1 Tage vor der WanderungVerhaltensregeln (Kodex) repetierenMeteo konsultieren, aktuelle Verhältnisse erfragenTel. Nr. 1600 kommunizieren (Auskunft über Durchführung)Handy-Akku laden..................................................................................................................................
Zuteilen der Aufgaben erledigt Aufgaben, die gemacht, besprochen oder kontrolliert werden müssen✗
Lehrperson Begleitperson Schüler 90 – 60 Tage vor der Wanderung✔
konsequent eingesetzt sind sie ein wich-tiger Baustein für die sichere Durch-führung der nächsten Exkursion. Die hier von der Schweizerischen Bera-tungsstelle für Unfallverhütung bfu vor-geschlagene Checkliste ist in Zusam-

25T I P P S4 a • 2 0 0 3
erledigt Aufgaben, die gemacht, besprochen oder kontrolliert werden müssen
Lehrperson Begleitperson Schüler Am Morgen und unterwegs
Zuteilen der Aufgaben ✗
✔
Tel. Nr. 1600 aktivierenTel. Nr. 1600 abhörenKlasse mit Routenangabe bei der Schulleitung abmeldenKurzcheck: Schuhe, Sonnenschutz, Notfallkarte Langsame und besonders zu Betreuende nach vorne nehmenAls 1. Begleitperson in der Mitte und als 2. am Schluss gehenDen richtigen Kartenausschnitt griffbereit haltenAuf Strassen in kompakter 2er-Kolonne rechts oder im Gänsemarsch links gehenRaststellen vor Bezug noch einmal checkenRegelmässig pausieren und stärken (trinken!) Teilnehmende periodisch zählenMeteo laufend beobachten und besprechenVor heiklen Passagen anhalten, Vorgehen besprechenSchwerwiegende Mängel an der Route fotografierenMängel der zuständigen Stelle melden..................................................................................................................................1 – 5 Tage nach der WanderungRückblendeDankesbrief (mit Fotos) an Begleitpersonen..................................................................................................................................
Wichtige Telefonnummern:
Notruf 117
Toxzentrum01 251 51 51
Rega 1414
✂
NotfallkarteRuhig bleiben, Unfallort sichern, 1. Hilfe leistenDiese Karte vor dem Telefonieren ausfüllenWer meldet? ............................................................................................................................Was ist wann passiert? ............................................................................................................
....................................................................................................... um .............................. UhrWo (Koordinaten, markanter Geländepunkt)? .........................................................................
....................................................................................................................................................Wer ist verletzt (Anzahl, Namen, Alter)? ..................................................................................
....................................................................................................................................................Wie ist die Verletzung? ............................................................................................................
....................................................................................................................................................Von wo aus telefoniere ich? ....................................................................................................
....................................................................................................................................................Tel.-Nr. für Rückrufe ...............................................................................................................
menarbeit mit J+S entstanden. Sie rich-tet sich an Lehrkräfte, SchülerInnenund Begleitpersonen und unterstreichtdamit, dass alle Teilnehmenden einerWanderung bereits in der Planungspha-se einen Überblick über zu erledigende
Schritte gewinnen und die Arbeit sinn-voll aufteilen können. Natürlich mussdie Checkliste immer den konkretenVerhältnissen angepasst werden. Ihre Meinung zum bfu-Vorschlag inter-essiert uns – Sie erreichen die Autoren
direkt unter [email protected]. WeitereUnterrichtsblätter der bfu zur Sicher-heitsförderung können Sie unterwww.safetytool.ch als pdf-Datei herun-terladen.
Christoph Müller, bfu

In einer Etappe ist er nicht zu bewälti-gen, der 60 Kilometer lange FricktalerHöhenweg. Aber zwischen Rheinfeldenim unteren und Mettau im oberenFricktal gibt es zahlreiche Einstiegs- undAusstiegsmöglichkeiten. Angeregt durch die gemeinsame ge-schichtliche Vergangenheit der beidenRheinbezirke, übernahmen Wanderbe-geisterte die Markierung attraktiverWegstrecken über die Jurahöhenzügedes Fricktals. Die blauen Wegweiser derHöhenroute tragen als verbindlichesSignet ein grünes Lindenblatt auf weis-sem Grund, das dem nur kurze Zeitbestehenden Kanton Fricktal (1802–1803) als Hoheitszeichen diente. DieBegehung ist dank guter Flur- undWaldwege und relativ geringer Höhen-differenzen nicht nur dem trainiertenWanderer möglich, sondern eignet sichauch für Schulklassen.
Znünihalt auf dem FlugplatzAusgangspunkt der Route ist mit 285 mü.M. der Bahnhof der ZähringerstadtRheinfelden. Die Route führt zunächstüber den bewaldeten Steppberg (395 m)hinauf zur langgestreckten Kuppe desMagdener Galgens (449 m) und steigtüber diesen Höhenzug bis zum Aus-sichtsturm und Rastort auf dem Son-nenberg (632 m). Von der Plattform desTurmes geniesst der Wanderer einenherrlichen Rundblick auf die Erhebun-gen des Baselbietes und den benachbar-ten Schwarzwald. Der Bergkrete folgend, fällt der Wegnach dem Dorf Zeiningen ab (340 m,Bushaltestelle) und erreicht nach erneu-tem Anstieg den Waldrand des Zeinin-gerberges oberhalb der Rebberge. Nachdem Spitzgraben folgt der landschaft-lich reizvolle Chriesiberg (545 m). Zum Flugplatz Schupfart (545 m) mar-schieren wir über die Tafeljura-Hoch-ebene von Looberg (571 m) und Wabrig(556 m).
Rundsicht auf dem höchsten Punkt Wer den Aufstieg über das Fazedeller-kreuz zum 749 m hohen Tiersteinberg
nicht direkt wagen will, kann sich imFlugplatzrestaurant oder aus dem Ruck-sack noch einmal stärken. Als Beloh-nung für den Aufstieg zum höchstenFricktaler Berg und die anschliessendeGratwanderung auf dem langgezogenenBergrücken, erwartet jeden Naturfreundam Aussichtspunkt (Rastplatz) einprächtiger Ausblick. Er wird im Nordenvon den Höhenzügen des Schwarzwal-des begrenzt. Der Abstieg zum histori-
schen Marktflecken Frick (361 m, Bahn-hof) führt an der Ruine «Alt-Tierstein»(630 m, Rastplatz) vorbei.
Von Rebberg zu RebbergDie Höhenroute erstreckt sich weitervom Bahnhof Frick (361 m) hinauf zumaussichtsreichen Waldrand des Frickber-ges und führt dem Wald entlang Rich-tung Hornussen. Kaum verlassen wirdas Gehölz, so öffnet sich vor uns dieWeite des Hornusser Rebhanges.Über den Grossacher (533 m) und denRastort Wettacher (614 m, Schutzhütte)gelangen wir zur südlichen Schynberg-halde, von wo aus der markante undaussichtsreiche Schynberg-Grat (722 m)zu erreichen ist. Eine Feuerstelle befin-det sich auf Punkt 691 direkt unterhalbdes Bergkreuzes. Hinunter gehts, amWaldrand entlang, zum Solbacher (611m), dann biegt der Höhenweg nachlinks ab und führt durch den March-wald (607 m) – vorbei an historischenGrenzsteinen – zum Weiler Sennhütten(634 m). Hier erwartet den Wandererein gut ausgebauter Rastplatz mit einerWaldschenke und Übernachtungsmög-lichkeit. Weiter geleitet uns der Weg zurAmpferenhöhe und nach einem kurzenWaldstück links hinauf zur Sternwarteund zum prächtigen Sulzer Aussichts-punkt Cheisacher (698 m).
27R E I S E Z I E L E4 a • 2 0 0 3
Ein Lindenblatt weist den WegEine Schulreise zum Jubiläum 200 Jahre Kanton Aargau und in Erinnerung anden Kanton Fricktal: Von Rheinfelden nach Mettau führt der blau markierteHöhenweg in mehreren Etappen 60 Kilometer weit über markante Jurahöhen.
Ein- und Ausstieg nach BeliebenRheinfelden (Bahnhof) – Sonnenberg 1 Std. 45 Min.– Dorf Zeiningen 2 Std. 20
Min. – Looberg 4 Std. – Flugplatz Schupfart (Restaurant) 4 Std. 50 Min. –Tiersteinberg (Aussichtspunkt) 6 Std. – Frick (Bahnhof) 7 Std. 30 Min.
Frick (Bahnhof) – Wettacher 1 Std. 45 Min. – Schynberg-Grat 2 Std. 30 Min. –Weiler Sennhütten 3 Std. 45 Min. – Aussichtspunkt Cheisacher 4 Std. 30Min. – Bürersteig-Passhöhe 5 Std. 30 Min. – Laubberg (Bergkapelle) 6 Std.15 Min. – Dorf Mettau (Kirche, Bushaltestelle) 7 Std. 15 Min.
Dank guter Bahn- und Postautoverbindungen können sich Wanderer indivi-duelle Streckenabschnitte von verschiedener Länge aussuchen. GeeignetesKartenmaterial: Aargauer Wanderkarte, Wanderkarte Liestal (Blatt 214 T),Blatt 214 Liestal, alle im Massstab 1:50 000.
Fortsetzung Seite 28
Auffällige blaue Wegweiser mitLindenblatt markieren die Route.
Foto
: Hei
nz
Web
er

Von der Kapelle zur BarockkircheVorwiegend im Wald verläuft anschlies-send die Höhenroute über die langgezo-gene Bergkuppe des Cheisachers, dannhin zum Passübergang Bürersteig-Höhe(555 m, Bushaltestelle). Um das Bürer-horn herum erreichen wir den Laubberg(648 m), dessen kleine Bergkapelle unszu einer kurzen Rast einlädt. Der Weg führt weiter, dem Stationen-und Gansinger Panoramaweg folgend,über den Höhenzug zwischen Oberh-ofen und Wil hinunter ins anmutigeMettauertal.
Max Mahrer, Initiant des Fricktaler Höhenwegs
Auskunft und Unterlagen zum Frickta-ler Höhenweg (Wandervorschläge fürGruppen, Übernachtungsmöglichkei-ten, Hinweise auf den öffentlichen Ver-kehr) bei Max Mahrer, Kraftwerkstrasse34, 4313 Möhlin, Tel. 061 851 14 73oder Tourismusbüro Rheinfelden, Tel.061 833 05 25.
notleidenden Fricktal. Es formierte sichWiderstand und bereits im September1802 wurde der fricktalische StatthalterSebastian Fahrländer gestürzt. Der Kan-ton Fricktal existierte aber weiter undschickte – wie die anderen Kantone – imJanuar 1803 eine Delegation nach Paris,wo die Mediationsverfassung von Napo-leons Gnaden ausgearbeitet wurde. DerKaiser erachte einen selbstständigenKanton Fricktal als «zu abenteuerlich»,meldeten die Fricktaler Gesandten nachHause. Und in der Tat schlug der mäch-tige Korse die beiden Bezirke Rheinfel-den und Laufenburg kurzerhand demAargau zu. Das Lindenblatt – Symbol des abenteu-erlichen Kantons – grünt dennoch wei-ter, zum Beispiel auf den Wegweiserndes Fricktaler Höhenwegs. hw.
Weiter im Netzwww.kanton-fricktal.ch/
28R E I S E Z I E L E4 a • 2 0 0 3
Abenteuer-licher KantonJenseits des Juras dürfte nur wenigenbekannt sein, dass es während rundeines Jahres einen Kanton Fricktal gab –eigenständiger Teil der helvetischenRepublik. Karl und Sebastian Fahrländer warenzwei fortschrittlich denkende Immi-granten; den Behörden des bis dahinkaiserlich-österreichischen Vorlandeswaren sie als «Revoluzzer» bekannt. ImWindschatten der Besetzung durchfranzösische Truppen und dank gutenBeziehungen zu helvetischen Polikerngelang ihr ehrgeiziger Plan: Sie gründe-ten Anfang 1802 zusammen mit weni-gen Getreuen den Kanton Fricktal.Die neuen Regierenden mit ihrem stür-mischen Reformkurs machten sichallerdings rasch unbeliebt in dem vondiversen Kriegsheeren geplünderten,

Eine Reise in den Koso... wo? «...klar,das ist doch bei..., also ... irgendwo dortunten im Balkan, da war doch malKrieg, weil der... äh... Dingsda... und des-wegen kamen doch alle diese Kosovo-Albaner, die ... aber die meisten sind jainzwischen wieder zurückgegangen.»
Christoph Zwahlen
Wir leben mit blinden Flecken in unse-rem Weltbild und -verständnis, und siestören uns kaum, bis wir vor Ort sehen,wie wenig wir von der Realität tatsäch-lich gewusst haben. Die Kursausschrei-bung der Lehrerinnen- und Lehrer-fortbildung versprach Einblicke in dasBildungswesen sowie das gesellschaftli-che Umfeld im Kosovo. Eine Gruppevon acht Lehrpersonen aller Schulstu-fen aus dem Kanton Basel-Landschaftliess sich auf dieses Angebot ein.
Neun Jahre ohne LehrerGrau und wolkenverhangen präsentiertsich der Himmel über der HauptstadtPrishtina, grau-sozialistisch die Platten-
bauarchitektur des Stadtbildes, bis derallabendliche Stromunterbruch allesgnädig in nächtliches Dunkel taucht.Die Universität von Prishtina wurde alsbisher einzige Hochschule in Kosova(der ehemaligen autonomen ProvinzKosovo) 1970 eröffnet. Mit dem Einset-zen der serbischen Expansionspolitikwurde der gesamte albanische Lehrkör-per zu Beginn der 90er-Jahre entlassenund der Lehrbetrieb faktisch eingestellt.1999 konnte der Betrieb unter interna-tionaler Leitung und mittels Finanzie-rung durch die EU wieder aufgenom-men werden. 20 000 Studierende sindan 14 Fakultäten in Ausbildung. Unumwunden benennt Hajredin Kuqivom Office for International Relationsder Universität die Folgen der knappenFinanzmittel: Anhebung der bisher be-scheidenen Studiengebühren und derKostenbeiträge in den Studentenwohn-heimen. Das Professorengehalt vonmonatlich 150 Euro bedingt einenZweitverdienst und senkt zudem dieSchwelle zur inoffiziellen «Erhöhung»durch Korruption.
Mangel an LehrkräftenAngegliedert an die Universität ist diePädagogische Fakultät für die Ausbil-dung der Lehrkräfte. Der vierjährigeAusbildungsgang (mit Praktika ab 2.Studienjahr) führt zur Unterrichtsbe-fähigung auf der Grundschulstufe (1.bis 4. Schuljahr) und auf der Sekundar-stufe I (5. bis 9. Schuljahr). Vorranggeniesst die Ausbildung neuer Lehrkräf-te; für die Weiterbildung der bisherigenLehrkräfte stehen keine Ressourcen zurVerfügung. Die faktische Auflösung des albanischenSchulwesens von 1990 bis 1999, dieFlucht vieler junger Albanerinnen undAlbaner ins Ausland, die knappen Mit-tel im Bildungswesen und die ungenü-gende Entlöhnung führten zu einemgravierenden Mangel an ausgebildetenLehrpersonen auf allen Schulstufen.
Im Nebenberuf Landwirt Kontrast: Das Dorf Rakosh. 50 Kilome-ter nordöstlich von Prishtina, am Fussdes Mokna-Gebirges, leben einige hun-dert Einwohner vorwiegend von Subsis-
304 a • 2 0 0 3
Mit eigenen Augen sehen – und verstehenFortbildung im ehemaligen Krisengebiet – Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kanton Basellanderlebten den Alltag und die Probleme ihrer Kolleginnen und Kollegen im Kosovo hautnah. EinReisebericht von Kursteilnehmer Christoph Zwahlen.
Begegnungen ingrosser Dichte undVielfalt: Die Reise-gruppe aus demBaselbiet in Prizren(Kosova).
Foto: Christoph ZwahlenFoto: Christoph Zwahlen

tenzlandwirtschaft (Selbstversorgung);es gibt eine Grundschule (1. bis 9.Schuljahr). Am Vortag unseres Besuches der Grund-schule von Rakosh begann der landes-weite Streik aller Lehrkräfte im Kosovo.Also kein Unterricht, dafür umso mehrRaum und Zeit für Gespräche undErfahrungsaustausch und einen aus-führlichen Rundgang durch die Schul-gebäude. Kahl und nüchtern sind dieUnterrichtsräume, das Mobiliar ist aufdas Notwendigste an Bänken und Tischenreduziert, frontal davor eine kleineWandtafel. Technische Unterrichtsmit-tel fehlen gänzlich; die prekären finan-ziellen Mittel bestimmen die Möglich-keiten. Unterrichtet wird in zweiSchichten: vormittags die Klassenstufen1 bis 4, nachmittags die Stufen 5 bis 9. Der Schulbesuch ist kostenlos, hingegenfinanzieren die Schülerinnen undSchüler ihr Unterrichtsmaterial selber,was auch für die Lehrkräfte gilt. DasMonatsgehalt von 130 Euro zwingtdiese geradezu, einem Zweitverdienstnachzugehen oder durch Landwirt-
schaft Lebensnotwendiges zu erarbei-ten. Weiterbildung für Lehrpersonen istunter diesen Voraussetzungen einFremdwort.
«Schattenschulen» fordern GeldWie an der Universität von Prishtinawurden zur Zeit der serbischen Ex-pansionspolitik sämtliche albanischenLehrpersonen entlassen und Albanischals Unterrichtssprache verboten. DieLehrkräfte hielten in Privathäusernalbanische «Schattenschulen» aufrecht.Nach Jahren unentgeltlicher Arbeit for-dern sie nun den ihnen angemessenscheinenden Anteil der reichlich flies-senden Aufbaugelder in Form einer sub-stantiellen Gehaltserhöhung.«Der Streik der Lehrkräfte im Kosovo»,so berichtet uns der Schulleiter, «dientvor allem einer Anerkennung unsererDienste. Zehn Jahre lang haben wir gra-tis gearbeitet, da Jugoslawien seit 1990der albanischstämmigen Bevölkerungweder Lohn noch Gebäude zur Verfü-gung gestellt hat. Wir wissen wohl, dasses dem Staat unmöglich ist, uns ange-
messen zu entlöhnen. 90 Prozent derBildungsausgaben werden von der EUgetragen. Die Regierung offeriert nun 40Euro Hilfsgeld monatlich. Das lehnt dieLehrerschaft ab. Wir wollen keineAlmosen-Empfänger sein.»
Ungleiche Verteilung Die Stadt Prizren beherbergt die einzigeGehörbehinderten-Schule des Kosovo.Während des Krieges wurde das Gebäu-de von den serbischen Sicherheitskräf-ten als Kaserne gebraucht, heute wirdder Wiederaufbau von deutschen Hilfs-werken finanziert. Und das Geldbewirkt den Unterschied zu den bisherbesuchten Schulen: Das Mobiliar derUnterrichtsräume, die Informatik-Aus-stattung, die sanitären Einrichtungen,die Grossküche des Internatsbetriebesentsprechen durchaus westeuropäi-schem Standard – ein Vorzeigeprojektwestlicher Aufbauhilfe und gleichzeitigBeispiel der Ungleichverteilung. Aberauch hier beteiligen sich die Lehrkräfteam landesweiten Streik, der Unterrichtruht und der Internatsbetrieb ist einge-stellt.
Fort-Bildung im besten SinnMit jedem Reisetag summieren sich dieEindrücke und Begegnungen: der Marktin der Kleinstadt; die Massengräber derKriegsopfer als Gedenk- und Kultstät-ten; in den Gesprächen immer wiederdie Versatzstücke von Flucht und Rück-kehr, die fehlenden Perspektiven derjungen Menschen, der Traum vom eige-nen Staat, der Wunsch, allem hier denRücken zu kehren...Die Reiseleitung von Anita Balaj-Brod-mann und ihrem kosovarischen MannGezim Balaj bot die Chance zu Ein-blicken und Begegnungen, die in dieserDichte und Vielfalt anderweitig kaumzu realisieren gewesen wären. WennReisen bilden, dann fand hier Fort-Bil-dung im besten Sinn statt.
31R E P O R T A G E4 a • 2 0 0 3
Zur Zeit der serbischen Expansionspolitik wurdensämtliche albanischen Lehrpersonen entlassen undAlbanisch als Unterrichts-sprache verboten. Die Lehr-kräfte hielten in Privat-häusern albanische «Schat-tenschulen» aufrecht.
Markt amStrassenrand in
Prizren:Landwirtschaft zur
Selbstversorgungist überlebens-
wichtig
Foto: Loretta van Oordt

324 a • 2 0 0 3
MAGAZINHinweiseBegegnung WasserDie Stiftung Bildung und Ent-
wicklung bietet mit einer Poster-
serie mit Begleitdossier und
einer Webseite zum Internatio-
nalen Jahr des Süsswassers Anre-
gung für Lehrpersonen. Mehr
Infos unter www.wasser2003bil-
dung.ch
Posterserie farbig, Format A2
und Begleitdossier Fr. 12.– inkl.
Versandkosten, Bestelladresse:
Stiftung Bildung und Entwick-
lung, Monbijoustrasse 31, 3011
Bern, Telefon 031 389 20 21,
Fax 031 389 20 29, Mail info@
bern.globaleducation.ch
Begegnung Alt und Jung Pro juventute vermittelt Kontak-
te zwischen jungen Bergbauern-
familien und Seniorinnen und
Senioren. Während den Som-
mermonaten helfen die Frei-
willigen entsprechend ihren
persönlichen Kräften und Nei-
gungen im Betrieb mit. Der
Sozialeinsatz im Berggebiet soll-
te mindestens zwei Wochen
dauern. Neben Pensionierten
sind auch im Berufsleben ste-
hende Personen willkommen.
Am 9. und 23. April und am 13.
Mai finden in Zürich Informati-
ons-Nachmittage statt. Auskunft
und Anmeldung unter Telefon
01 256 77 79, Fax 01 256 77 78,
Mail [email protected] oder
www.projuventute.ch
Begegnung im Verkehrs-haus LuzernDer Einbaum vom Bielersee, ein
Blick in den Weltraum, die Welt
der Lastwagen und andere High-
lights: Das Verkehrshaus der
Schweiz in Luzern lädt Lehrper-
sonen am 14. Mai von 10 bis 18
Uhr ein zur freien Besichtigung,
Kurzführungen zu speziellen
Themen und zum neuen Imax-
Filmtheater «Wunderwelt der
Meere». Es liegen Unterrichts-
materialien, Bastelbogen, Führer
und Dokumentationen auf. Ver-
kehrshaus der Schweiz, Bildung
und Vermittlung, Lidostrasse 5,
6006 Luzern, Tel. 041 370 44 44,
Fax 041 370 61 68, E-Mail sibyl-
www.verkehrshaus.org
und einfühlsame Art, fremdeMenschen zu fotografieren,kommt in der Ausstellungzum Ausdruck. Kinder zwi-schen sechs und zwölf Jah-ren werden zu einem Reise-spiel eingeladen und lernenLebensart und Kultur fernerLänder kennen. Wer Lusthat, kann unter anderemausprobieren, wie man einengefüllten Korb mit einemStirnriemen trägt. Der Aus-stellungsbereich für Jugend-liche und Erwachsene prä-sentiert sich als klassischeFotoausstellung. Kontakt: SchweizerischesAlpines Museum, Helvetia-platz 4, 3005 Bern, Telefon031 351 04 34, www.alpines-museum.ch
Termine
Zeit zum BadenDas Historische Museum St. Gal-
len zeigt ab 5. April bis 10.
August «Badefreuden». Die Wan-
derausstellung aus dem Schloss
Kyburg vermittelt Interessantes
rund um das Baden und die Kör-
per- und Schönheitspflege vom
Spätmittelalter bis in die neuere
Zeit. Mittelpunkt der Ausstel-
lung ist ein Bad- und Schwitz-
haus, wie es einst im Schlosshof
des Landvogts stand. Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Freitag 10
bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Sams-
tag und Sonntag 10 bis 17 Uhr.
Information unter Telefon
071242 06 42, Fax 071 2420644.
Zeit zum LanddienstDer Landdienst bietet Ferienjobs
für Jugendliche zwischen 14 und
25 Jahren unter dem Motto
«Power beim Bauer». Jugendli-
che können im in- und auslän-
dischen Landdienst vielfältige
Erfahrungen machen, Kontakte
knüpfen und die Arbeit in der
Landwirtschaft kennen lernen.
Information: www.landdienst.ch
oder Tel. 0900 571291.
Zeit für MusischesAm Mittwoch, 14. Mai, findet in
Frauenfeld die 47. internationale
Musische Tagung statt. Lehrper-
sonen aus dem Kanton Thurgau
stellen mit ihren Schülerinnen
und Schülern verschiedenste
Projekte aus den Bereichen Mut-
ter-/Fremdsprache, Musik, Tanz,
Sport, Spiel, Kunst, Natur und
Technik, Ernährung vor. Die
Werkschau soll eine Ideenbörse
für Lehrpersonen sein. Die Pro-
grammbroschüre ist erhältlich
unter www.imta2003.ch.
Zeit für BubenarbeitAm Samstag, 17. Mai, lädt das
Netzwerk Schulische Buben-
arbeit Lehrpersonen, Ausbildne-
rinnen und Ausbildner, Schul-
behörden und weitere Inte-
ressierte zu einer Impulstagung
unter dem Titel «Es ist Zeit für
Bubenarbeit» in die Kantons-
schule Oerlikon. Anmeldung
und Info unter 01 825 62 92 oder
Das Schweizerische AlpineMuseum in Bern durfte letz-tes Jahr das fotografischeLebenswerk des verstorbe-nen Berner Bergsteigers DölfReist als Schenkung entge-gennehmen. Vom 6. Märzbis 9. Juni zeigt das Museumnun einen Teil seiner Bilderunter dem Aspekt «Kinderreisen um die Welt». AbMitte der 70er Jahre bereisteDölf Reist über 30 Länderund dokumentierte ein viel-seitiges Bild der Landschaftund der darin lebendenMenschen. Nicht nur dieGesichter der Berge faszinier-ten ihn, sondern auch diefragilen Gesichter der Men-schen, vor allem jene derKinder. Seine behutsame
Schwere Last für Kinder in Nepal: Foto von Dölf Reist ausdem Jahr 1985.
Foto: zVg.
Alpines Museum
Reisen mit Dölf Reist

Verschiedene Studien belegen, dass sichdie überwiegende Mehrheit der Jugend-lichen nicht für Politik interessiert. Ineiner deutschen Untersuchung werdenheutige Jugendliche gar als Generationvon «Ego-Taktikern» charakterisiert, de-ren Lebensprogramm individueller Er-folg in Ausbildung und Beruf, Lustmaxi-mierung in der Freizeit ist.
Christian Graf-Zumsteg
Von den Stimmabstinenten bei denWahlen 1999 (immerhin gesamthaft56,7% der Stimmberechtigten) sind14% einer Gruppe der «Inkompeten-ten» zuzuordnen. Gerade in dieserGruppe sind viele jüngere Wählerinnenund Wähler zu finden. Nicht Wählende
verfügen über eine tiefere Schulbildung,ein geringeres berufliches Ausbildungs-niveau und ein tieferes Einkommen.
Jugendliche auf der Strasse20. März 2003: In den Morgennachrich-ten die Meldungen über den Kriegsbe-ginn im Irak. Truppen der USA undGrossbritanniens bombardieren die ira-
37Z U R Z E I T4 a • 2 0 0 3
Die «Ego-Taktiker» auf der StrasseAls der Irakkrieg begann, gingen Tausende von Schülerinnen und Schülern auf dieStrasse und überraschten damit viele, die unsere Jugend für unpolitisch hielten.«Jugend und Politik» ist Thema der nächsten Ausgabe der Zeitschrift «Zur Zeit»; sieerscheint Ende Mai. Wir bringen aus aktuellem Anlass einen Vorabdruck des Einführungstextes von «Zur Zeit»-Redaktor Christian Graf sowie Stimmen von Jugendlichen.
Widerspruch zwischen Studien und Realität? – Jugendliche demonstrieren gegen den Irak-Krieg.
Foto
s: z
Vg
.

kische Hauptstadt Bagdad, ohne Legiti-mation der UNO. Millionen von Men-schen auf der ganzen Welt und dieMehrheit der Staaten im UNO-Sicher-heitsrat haben dies nicht verhindernkönnen.Ein paar Stunden später verlassen Zehn-tausende Schülerinnen und Schüler ihre Schulhäuser, um ihre Gefühle vonOhnmacht, Wut und Trauer auf derStrasse auszudrücken; häufig werden sievon ihren Lehrpersonen oder Schullei-tungen dazu ausdrücklich ermuntert. Sekundarschüler Marco aus Oberriedenhat vor zwei Wochen zum ersten Mal inseinem Leben demonstriert. «Ich binhier, weil ich so schulfrei habe», sagt er,«und weil ich gegen den Krieg bin.»Sein Lehrer Johannes Barz ist auch da.«Man kann die Teilnahme an dieserDemo auch als Sensibilisierung fürdemokratisches Handeln sehen», erklärtder Pädagoge.In einer Empfehlung des kantonalenMittelschul- und Berufsbildungsamteswaren die Schulen im Vorfeld angewie-sen worden, Schülerinnen und Schülernicht an einer Teilnahme an den Kund-gebungen zu hindern. Angesichts derTragweite und der grossen Betroffenheitdes Kriegs habe man grosses Verständ-nis für die Anliegen der Schüler, sagteAmtsvorsteher Theo Ninck auf Anfrage.
Was leistet politische Bildung?Die «Ego-Taktiker» auf der Strasse: Passtdies zusammen oder ist hier ein Wider-spruch zwischen Studien und Realitätauszumachen?Wo und in welchem Zusammenhanggeschieht politische Sozialisation wäh-rend der Jugendzeit zwischen 14 und 18Jahren? Sind es primär Familie undFreundeskreis oder die Medien? WelcheRolle spielt dabei die «politische Bil-dung» in der Schule, um die es – eben-falls gemäss Studien – so schlecht be-stellt ist?Sind Jugendliche primär an globalenAspekten politischer Themen interes-
siert (wie Frieden, Umwelt)? Wie wich-tig ist es, sich freiwillig und selbstgewählt mit politischen Themen undAktionsformen befassen zu können,statt in strukturierten und angeleitetenBildungsprozessen? Ergibt sich politi-sches Lernen nicht viel mehr als Neben-effekt zur konkreten politischen Aktion,in deren Zentrum zuerst das gemein-same Erlebnis und das Gefühl der Zuge-hörigkeit stand?Es kann durchaus sein, dass die Bewe-gung gegen den Irakkrieg (sda: «eineneue Jugendbewegung ist entstanden»)viele Jugendliche dazu bringt, sich ver-mehrt mit politischen Zusammenhän-gen zu beschäftigen. Auch ich habe diesals Kind erlebt, als wir 1968 spontaneDemonstrationen gegen den Einmarschsowjetischer Truppen in Prag organisierthaben. Es waren meine ersten politi-schen Erfahrungen, erstmals stellte ichim Zusammenhang mit einem politi-schen Ereignis Fragen wie «Warum?»und «Kann man denn nichts dagegentun?».
Die Ohnmacht verarbeitenSicher scheint mir dies: Die Zugehörig-keit zu einer Gruppe von Gleichgesinn-ten, das Verarbeiten von Ohnmachtsge-fühlen, die Überwindung der Isolationin solch aufwühlenden Momenten isteine wichtige persönliche, gleichzeitigaber auch politische Erfahrung. Damitverbunden ist auch die Einsicht, dassein politisches Engagement Spass undpersönliche Befriedigung bringen kann.Und noch etwas: Jugendliche werdensich eher für zeitlich befristete, abge-schlossene politische Initiativen gewin-nen lassen als für eine Mitarbeit in poli-tischen Strukturen mit einer längerenzeitlichen Verpflichtung. Sind sie des-wegen «Ego-Taktiker»?Gerhard de Haan, Professor am Institut fürerziehungswissenschaftliche Zukunfts-forschung in Berlin, hat die fünf Bedin-gungen für ein politisches EngagementJugendlicher wie folgt beschrieben:
• Es muss Spass machen• Ich kann das gemeinsam mit meiner
Clique machen• Ich kann entscheiden, wann ich aus-
steige• Hier kann ich zeigen, was ich schon
kann• Das bringt mir was für die Zukunft
Gemäss seiner Einschätzung sind diekonventionelle Politik und die Verbän-de bei den heutigen Jugendlichen«out», während das soziale Engagementund die «entgrenzte» Politik «in» sind. Wie steht es um das Interesse Jugendli-cher an Politik? Welche Erwartungenhaben sie an die Erwachsenen und andie Schule als Lernort? Wofür wären siebereit, sich aktiv einzusetzen? Und ganzzentral: Wo machen Jugendliche heuteErfahrungen, die ihr Interesse an derPolitik wecken?Dies waren die Fragen, die uns bei derEntwicklung der Ausgabe «Zur Zeit:Jugend und Politik» beschäftigten. Wirwollen mit dem Heft nicht Antwortenvorlegen, sondern Sie als Lehrpersonanregen, mit Ihren Schülerinnen undSchülern über das eigene Bild von Poli-tik, die eigenen Erfahrungen mit politi-schen Prozessen nachzudenken. DieSchule ist der Ort, wo Jugendliche mitGleichaltrigen und angeleitet eine ver-tiefte Reflexion führen können. DieSchule kann aber auch Erfahrungsraumsein. Damit führt diese Ausgabe dasThema Mitbestimmung/Partizipationweiter, dem eine frühere Ausgabe von«Zur Zeit» gewidmet war.
384 a • 2 0 0 3
Wo und in welchem Zusammenhang geschieht politi-sche Sozialisation während der Jugendzeit zwischen 14 und 18 Jahren? Sind es primär Familie und Freundes-kreis oder die Medien? Welche Rolle spielt dabei die«politische Bildung» in der Schule, um die es – ebenfallsgemäss Studien – so schlecht bestellt ist?

39Z U R Z E I T4 a • 2 0 0 3
Die Themen sind zu weit weg
Ich finde, dass auch Jugendliche wissen sollten, worum es in der Politik geht. Aber natürlich weiss ich nicht detailliert über alles Beschied. Ich versuche mich aber über verschiedene Medien zu informie-ren. Momentan ist es vor allem die Auslandpolitik, mit der ich mich beschäftige. Und gleichzeitig ver-folge ich, was in der Schweiz so läuft. In der Schule sprechen wir kaum über politische Themen, eher zuHause, mit den Eltern. Politik ist ja kein Thema, worüber man in der Freizeit und mit Freunden gerne spricht. Alexandra Schmid, 14
Wir sollten zumindest angehört werden
Ich interessiere mich für Politik, weil es einfach wichtig ist, dass man weiss, was in der Welt passiert. Dennschlussendlich kommt alles auf uns zurück, was in der Politik beschlossen wird. Natürlich beschäftigtmich momentan vor allem der Irakkrieg; ich bin gegen diesen Krieg und finde, sie sollten langsam brem-sen mit ihren Kriegsplänen. Ich finde, Jugendliche sollten an grossen Abstimmungen mehr zu sagen haben. Zumindest sollten dieJugendlichen befragt werden, was sie denken, welches ihre Meinung zu einem Thema ist. Es sollte immerauch Meinungsumfragen bei Jugendlichen geben. Jugendliche sollen vielleicht nicht voll abstimmenkönnen, aber mindestens hören sollte man, was sie dazu zu sagen haben. Manchmal diskutiere ich zu Hause mit meinen Eltern über politische Themen; mein Vater ist Politiker.Natürlich weiss ich einiges auch von ihm, wie es läuft in der Politik und so, aber ich habe mich auch sel-ber informiert. Adrian Bircher, 14
Wir sollten abstimmen können
Mich beschäftigt der Irakkonflikt, obwohl ich mich für Politik nicht interessiere. Denn ich sehe die Bilderim Fernsehen und finde es einfach schlimm, dass einige den Krieg wirklich wollen. Und dies, obwohl diemeisten hier in Europa dagegen sind. Darum verstehe ich die Politik manchmal nicht. Zum Thema Jugend und Politik denke ich, dass Jugendliche abstimmen können sollten, allerdings so,dass ihre Stimme nicht voll zählt. Weil man als Jugendlicher vielleicht noch nicht reif dazu ist. Abergrundsätzlich denke ich schon, dass Jugendliche auch etwas von politischen Themen verstehen. Wennich etwas ändern könnte an der Politik, dann würde ich versuchen das, was im Hintergrund alles ge-schieht, an die Öffentlichkeit zu bringen. Dalibor, 14
Erwachsene wissen es besser
Manchmal verstehe ich, was die Politiker machen, andere Themen hingegen sind einfach langweilig, dar-um interessiere ich mich nicht für Politik. Trotzdem fände ich es gut, wenn auch Kinder mitmachenkönnten in der Politik, aber bei Jugendlichen bin ich nicht so sicher. Manchmal wissen die Erwachseneneinfach besser, worum es geht, weil sie mehr Erfahrungen haben. Abstimmen würde ich gerne und wennich 18 bin, werde ich dies auch tun. Beispielsweise wäre ich gegen die Einführung des grünen L, das fin-de ich blöd. Dominique Zweifel, 13
Es liegt an den Politikern
Ich interessiere mich für Politik. Mich interessiert daran, dass Politik der Ort ist, an dem Dinge bestimmtwerden, die dann jeden von uns betreffen. Momentan beschäftigt mich vor allem der Krieg. Die Jugend interessiert sich ganz klar zuwenig für die Politik. Und dies liegt eindeutig bei den Politikern!Ich kann ein Beispiel nennen: Wenn sie bei der Schule immer Gelder streichen, dann machen sie sich beiJugendlichen nicht sehr beliebt. Oder wenn Jugendprojekte nicht weiter finanziert werden, freut uns dasnicht sehr. Mit solchen Entscheiden machen sich Politiker sicherlich nicht beliebt bei den Jugendlichen!Darum finde ich, dass Politiker mehr auf die Jugend eingehen sollten. Indem sie beispielsweise eineJugendorganisation ermöglichen würden, die wirklich nur für Jugendliche da ist. Katja Fischer, 15

40Z U R Z E I T4 a • 2 0 0 3
Im neuen Heft«Zur Zeit» trifft...Eine Sekundarklasse trifft StänderätinChristine Beerli: Welches waren dieErwartungen der Jugendlichen an dasGespräch, wie beurteilen sie es im Rück-blick?
(Un-)Politische Jugend? Was meinen 13- bis 18-Jährige zur Poli-tik? Die Aussagen zeigen, welche Erwar-tungen Jugendliche an sich und an dieErwachsenen haben.
Ausserdem• Drei Jungpolitiker und -politikerin-
nen im Porträt: Wo genau kommt ihrInteresse an Politik her?
• Die Jungparteien präsentieren sich inganzseitigen Anzeigen: Was haben sieJugendlichen zu bieten?
• Eltern und ihre Kinder im Gespräch:Entscheidet sich im Elternhaus, ob Ju-gendliche Zugang zur Politik finden?
• Greenpeace, amnesty international,WWF: Was haben Nichtregierungsor-ganisationen Jugendlichen zu bieten?
• Politik in der Schule: Erfahrungeneiner Schulklasse, die in der Gemeindeein Projekt realisieren konnte: Dankoder trotz der politischen Abläufe?
• Selber politisch aktiv werden: Wasbraucht es dazu? Eine Checkliste.
Kommentar für LehrpersonenDer Kommentar für Lehrpersonen istneu zweigeteilt: Im ersten Teil (wie bis-her in gedruckter Form) werden der Auf-trag, die Beurteilung und Grundsätzeder politischen Bildung in der Schulereflektiert. Erfahrungen von Lehrperso-nen mit politischen Themen im Unter-richt geben einen Einblick in die Praxis.Der zweite Teil – Anregungen, wie mitdem Heft im Unterricht gearbeitet wer-den kann, Aufträge und Kopiervorlagen– wird neu auf dem Internet veröffent-licht und soll aktualisiert werden. Mit dem Kauf des Sets (Heft und Kom-mentar) erhalten Sie Zugang zu denMaterialien im Internet.
Zur Zeit: Jugend und PolitikSchulverlag blmv/LCH, Bern 2003Heft, 32 Seiten A4, vierfarbig, Arti-kel-Nr. 5.265.00, Fr. 4.– (Mindestbe-stellmenge 10 Ex.) – Set (Heft undKommentar mit Zugang zum Inter-net), Artikel.-Nr. 5.273.00, Fr. 15.–Das Heft erscheint Ende Mai.Bestellungen: www.schulverlag.ch
Den eigenenZugang findenDie Zielsetzungen der Reihe«Zur Zeit».
Die Zeitschriftenreihe «Zur Zeit» wirdseit rund eineinhalb Jahren gemeinsamherausgegeben vom Schulverlag blmvund BILDUNG SCHWEIZ. Sie vermitteltSchülerinnen und Schülern der Se-kundarstufen I und II Informationenund Hintergründe zu Themen, die zur-zeit im Zentrum des öffentlichen Inter-esses stehen – oder die in den nächstenMonaten für Aufmerksamkeit sorgenwerden. Ziel der Reihe ist es, die politi-sche Bildung der Jugendlichen zu för-dern, ihr Interesse an politischen undgesellschaftlichen Zusammenhängen zuwecken, sie zur Partizipation an deröffentlichen Diskussion und Entschei-dungsfindung aufzufordern.
Lust an der Auseinandersetzung«Zur Zeit» bedient sich journalistischerGestaltungsformen, orientiert sich je-doch nicht an aktuellen journalisti-schen Trends, betreibt also beispielswei-se keinen Thesenjournalismus. JedeAusgabe von «Zur Zeit» folgt einem spe-ziellen Gesamtkonzept (in Zusammen-hang mit dem Kommentar für Lehrper-sonen). Die Themen werden sopräsentiert, dass Jugendliche einen eige-nen Zugang finden, die Informationensind möglichst objektiv, Jugendlichesollen nicht von einem Pro oder Kontraüberzeugt werden, vielmehr gilt es, ihrInteresse, ihre Lust an der Auseinander-setzung zu wecken. Schülerinnen undSchüler sollen befähigt werden, sichweitgehend unabhängig eine Meinungzu bilden – und diese auch zu vertreten. Die Mitbeteiligung Jugendlicher bei derKonzipierung, Entwicklung und Aus-wertung der einzelnen Ausgaben wirdangestrebt.Wir bemühen uns darum, Texte, Lese-hilfen und Gestaltung so zu präsentie-ren, dass Jugendliche ab 13 Jahren mitdem Heft selbstständig arbeiten kön-nen, auch wenn das Heft nicht explizitdidaktisiert ist. Die einzelnen Beiträgesind in sich abgeschlossen, so dass dasHeft auch auszugsweise und für kurzeEinheiten zu verwenden ist.Bewusst sind unterschiedliche Textsor-ten und -längen zu finden, dochbemühen wir uns um eine Sprache, diejunge Erwachsene anspricht und ihnen
verständlich ist. Nicht immer könnenwir unseren Anspruch einlösen. Des-halb enthält der Kommentar für Lehr-personen Anregungen, wie das Heft imUnterricht eingesetzt werden kann.Konkrete Arbeitsmaterialien zu denHeftbeiträgen finden sich neu nur nochauf dem Internet.
Ausrichtung und Inhalte der Ausgabe«Jugendliche und Politik»«Zur Zeit: Jugend und Politik» will Poli-tik aus Sicht der Jugendlichen aufarbei-ten, ihre Perspektive ergründen, ihr(Nicht-?)Interesse thematisieren.Im Zentrum steht also nicht ein erneu-tes Aufarbeiten der Staatskunde (dies istin den gebräuchlichen Geschichtslehr-mitteln bereits vorhanden), sondern einHeft, das sich aus vielen Perspektivenmit der Frage beschäftigt, ob und woJugendliche politisch aktiv sind, auswelchen Motiven und mit welchem per-sönlichen Gewinn, was Jugendliche vonErwachsenen dabei erwarten und umge-kehrt.Das Heft führt demnach einerseits dasThema «Partizipation» (vgl. Zur Zeit:Mitbestimmung) weiter, beschäftigtsich aber mit den parlamentarischenund speziell den ausserparlamentari-schen Möglichkeiten für Jugendliche.Speziell interessiert die Frage, woherJugendliche ihre Meinungen und Auf-fassungen über die Politik und ein eige-nes politisches Engagement haben, wel-ches die stärksten Einflussgrössen inihrer politischen Sozialisation sind.Belegt ist, dass die Schule bzw. die Lehr-person im politischen Unterricht dabeinicht eine herausragende Stellung einnimmt. Vielmehr sind die Eltern für 12- bis 16-Jährige die zentralenGesprächspartner in politischen Angele-genheiten.Die Schule kann aber der Ort sein, wosich Jugendliche bewusst mit ihrer Her-kunft, ihren Vorstellungen und Mei-nungen beschäftigen und diese mitanderen Gleichaltrigen austauschen.
Christian Graf-Zumsteg
Weiter im Netzwww.schulverlag.chwww.schulimpuls.ch

Impressum BILDUNG SCHWEIZ erscheint monatlichBILDUNG SCHWEIZ-Stellenanzeiger erscheint inallen Ausgaben sowie nach Bedarf separat; 148. Jahrgang der Schweizer Lehrerinnen- undLehrerzeitung (SLZ)
Herausgeber/VerlagDachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
(LCH)• Beat W. Zemp, Zentralpräsident, Erlistrasse 7,
4402 Frenkendorf E-Mail: [email protected]
• Urs Schildknecht, ZentralsekretärE-Mail: [email protected]
• Anton Strittmatter, Leiter PädagogischeArbeitsstelle LCH, Jakob-Stämpflistr. 6, 2504 Biel-BienneE-Mail: [email protected]
Zentralsekretariat/Redaktion: Ringstrasse 54, Postfach 189, 8057 Zürich
Telefon 01 315 54 54 (Mo bis Do 8.00 bis 9.00und 13.00 bis 17.00 Uhr, Fr bis 16.00 Uhr)Fax 01 311 83 15, E-Mail: [email protected]
Redaktion• Heinz Weber (hw.), Verantwortlicher Redaktor,
Doris Fischer (dfm.), RedaktorinE-Mail: [email protected]
• Peter Waeger (wae), Grafik/Layout E-Mail: [email protected]
Ständige MitarbeitMadlen Blösch (mbl.), Thomas Gerber (ght.), UteRuf, Martin Schröter (ms.), Pia Wermelinger (pia),Adrian Zeller (aze.)
Internetwww.lch.chwww.bildungschweiz.chAlle Rechte vorbehalten.
Abonnemente/AdressänderungenZentralsekretariat LCH, Postfach 189, 8057 Zürich,Telefon 01 315 54 54, E-Mail: [email protected]ür Aktivmitglieder des LCH ist das Abonnementvon BILDUNG SCHWEIZ im Verbandsbeitragenthalten.
Schweiz AuslandJahresabonnement Fr. 95.50 Fr. 162.–Studierende Fr. 67.50
Einzelexemplare: Fr. 12.– jeweils zuz. Porto/Mwst. (ab 5 Exemplaren halber Preis)
DienstleistungenBestellungen/Administration: Zentralsekretariat LCHE-Mail: [email protected]/Reisedienst: Martin SchröterE-Mail: [email protected]
Inserate/DruckInserate: Kretz AG,Zürichsee Zeitschriftenverlag, 8712 StäfaTelefon 01 928 56 09, Fax 01 928 56 00Postscheckkonto 80-3-148Anzeigenverkauf: Martin Traber E-Mail: [email protected]: Zürichsee Druckereien AG, 8712 Stäfa
ISSN 1424-6880
41I M P R E S S U M4 a • 2 0 0 3

47R U F N U M M E R4 a • 2 0 0 3
Abschluss-Ausflug mit meiner dritten Klasse. Ich miete das Jugendhaus in Boldern,wunderschön gelegen, hoch überm Zürichsee. «Kannst du mir helfen, das Bett zu beziehen? Meine Arme sind zu kurz.» 20 mal helfe ich. Habe nämlich keine Begleitung dabei. Das hätten sie hier noch niegehabt. Übernachtung ohne Begleitung. «Ist das überhaupt erlaubt?», fällt mir jetztein.Ich koche auch für 20 zu Mittag, aber bevor jemand in Bewunderung erstarrt, mussich sagen: Nur fertigfrische Pizza in den Backofen. Trotzdem bin ich anschliessendmüde und lege mich aufs Bett. Darf man das? Schrecke sowieso bald aus dem Dösenauf, als plötzlich ein Fell mein Gesicht streift, uäähh!! Es ist ein Hund – der Stoff-hund von Jill, den sie mir hat heimlich in den Arm legen wollen. Sie steht mit einerHolzlatte vor meinem Bett. «Was machst du damit?» – «Dich beschützen. Bin vorder Tür.»Dann wird gespielt, Fussball, Tischtennis und Tabu, im Zimmer rumgewispert undrumgewuselt, denn die Vorbereitungen für die Disco laufen schon ab fünf Uhr aufHochtouren. Erst mal die Stühle so hinstellen, dass man nicht drauf sitzen kann.Wir kennen unsere Pappenheimer, die Buben. Für die gilt sowieso: Wer nicht tanzt,fliegt raus bzw. braucht gar nicht erst reinzukommen in unseren Raum, bei demjetzt schon die Vorhänge gezogen sind, das Licht gedimmt ist, die CDs spielbereitneben dem Player liegen und bunte Ballone auf dem Boden.Zum Znacht gibts Entenhausener Wursttopf und ich erkläre nicht, wies geht, dennes geht zu lange. Gleich beginnt die Disco. Die Mädchen duschen, putzen sich die Ohren, Creme insGesicht, Gel in die Haare und dann das Glitzertop. Die Buben kommen direkt voneiner letzten Fussballrunde in die Disco. «Sind wir schön?» fragen die Mädchen.«Ja!» Dann wird getanzt. Zu Anastacia und Co. Die Ballone entfernen wir nach fünfMinuten, weil die Buben geglaubt haben, Ballone werfen sei auch tanzen. Irgend-wann aber ist die Luft auch bei uns draussen. Um halb zehn sage ich: «Zieht denPyjama an!» – «Und dann?» – «Dann geht ihr ins Bett.» Um Viertel nach zehn die Runde. «Wenn ich im Gang noch ein lautes Wort höre,geht diese Person in ein leeres Zimmer zum Schlafen.»Nun kann ich kein lautes Wort mehr hören, weil meine Person nach einem zweitenKontrollgang auch in ein leeres Zimmer geht, sofort einschläft und erst um halbacht wieder erwacht. So sei es auch den andern ergangen, erfahre ich beim Frühstück auf der Wiese. Blau-er Himmel, strahlender Sonnenschein und der See da unten und die Kinder fröhlichan den beiden Holztischen und niemand hat ins Bett brünzlet und niemand hatteHeimweh und alle total happy nach dieser wahnsinnigen Disco-Nacht.Heimweg. Munter den Berg hinunter. Postauto, S-Bahn, Bähnli – alles kommtirgendwann, ich reise diesmal ohne Fahrplan.Dann zerstreuen wir uns. Fabio geht neben mir. Er sagt leise: «Da vorne, der Raffael,siehst du, wie er den Kopf so nach unten hält? Er weint.» «Weshalb?»«Merkst du nicht, dass er keinen Rucksack anhat?» «Ach ja, stimmt.»«Den hat er im Zug liegenlassen.»
Glitzertop und Schmuddelshirt
BILDUNGSCHWEIZdemnächst
• Bildung als DienstleistungRund 100 000 Schülerinnen und Schü-ler in der Schweiz besuchen gegenwär-tig eine nicht staatliche Schule. ElitäreBildungsstätten für Kinder Gutbetuch-ter? Horte avantgardistischer Pädago-gik? Nötige Ergänzung des staatlichenBildungsmenüs? BILDUNG SCHWEIZhat sich mehrere Privatschulen näherangesehen.
• Buschor adeVor acht Jahren trat er an, die Bildungs-landschaft seines Kantons, ja der gan-zen Schweiz umzupflügen. Jetzt tritt derumstrittene Zürcher Regierungsrat undBildungsdirektor Ernst Buschor zurück.Wir ziehen Bilanz.
• Was zu tun istWas bleibt übrig, wenn man von denErwartungen der Gesellschaft an dieSchule das Überflüssige wegstreicht, dieZumutungen zurückweist und das Un-mögliche gar nicht erst versucht? DerLCH legt im Vorfeld der Fachtagungvom 24. Mai in Hergiswil NW seineThesen zum Kernauftrag vor.
Die nächste Ausgabe erscheintam 29. April.
Ute Ruf